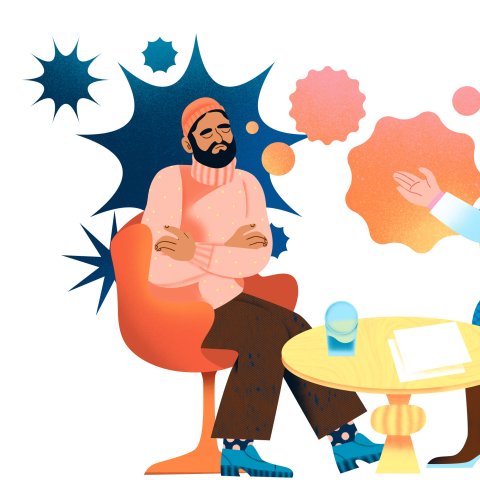Die Nachricht war wie Wasser auf die Mühlen der Skeptischen: Über die Gesundheitsapp „Ada“ seien sensible Patientendaten an US-amerikanische Unternehmen gelangt, stand vor einigen Wochen in den Zeitungen. Die Smartphone-Anwendung, die mehr als fünf Millionen Mal heruntergeladen worden ist, deutet Krankheitssymptome. Eigentlich eine hilfreiche Sache. Doch welcher Nutzer wollte schon, dass am Ende Facebook weiß, ob er Bluthochdruck hat?
Für die Befürworter von Digital Health war das Ada-Leck ein Rückschlag. Denn geht es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dürfen Ärzte in Deutschland solche Gesundheitsapps demnächst verschreiben. Auf Kosten der Krankenkassen dokumentieren Diabetiker dann ihre Blutzuckerwerte oder erinnert das Handy an die Medikamente. Das soll die Behandlung und Therapietreue verbessern. Neben Apps auf Rezept sind elektronische Rezepte und Videosprechstunden wichtige Punkte im „Digitale Versorgung Gesetz“, mit dem Spahn das Gesundheitswesen aus dem analogen Koma wecken will.
Spahns Idee ist umstritten, Deutschlands Rückstand jedoch unbestritten: Als die Bertelsmann-Stiftung die Digitalisierungsstrategien im Gesundheitsbereich verglich, landete Deutschland auf einem ernüchternden 16. Platz – von 17 Ländern. „Digital Health entwickelt sich hier sehr langsam“, bestätigt Dr. Erwin Böttinger, Professor für „Digital Health – Personalized Medicine“ und Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. „Während sich die Bürger anderswo gar keine Gedanken mehr darüber machen, dass ihre Gesundheitsdaten digitalisiert sind, schlafen die Deutschen noch.“
Dabei könnten Patienten enorm profitieren, sagt Böttinger: „Weil digitale Daten vernetzbar wären, gäbe es keine unnötigen Untersuchungen mehr. Ein Arzt, bei dem sich ein Patient eine Zweitmeinung einholt, müsste kein neues Röntgenbild machen, sondern könnte sich einfach das erste ansehen.“
In Böttingers zweiter Heimat, den USA, ist es gang und gäbe, dass Patienten den Überblick über ihre Gesundheitsdaten haben, erzählt der Professor: „In einer App auf meinem Handy sind meine Medikamente gespeichert, Laborwerte, Vorsorgechecks und Impfungen. Ich kann sehen, dass in zwei Jahren die Darmspiegelung zur Krebsvorsorge ansteht oder wann die nächste Tetanusimpfung fällig ist.“ Mit seinem Arzt könne er sogar übers Handy chatten, wenn er eine Frage habe, berichtet Böttinger: „Das spart jede Menge Zeit, denn ich muss dafür nicht die gestresste Arzthelferin am Telefon nerven oder in die Praxis gehen.“
Bis uns der Hausarzt die Cholesterinwerte aufs Handy schickt, wird wohl noch einige Zeit vergehen. „Der Streit über den Nutzen und Austausch von Daten bremst die Weiterentwicklung von Digital Health in Deutschland“, klagt Böttinger. „Natürlich birgt die Digitalisierung Risiken, die wir weder leugnen noch ignorieren dürfen. Doch für die Patienten überwiegt bei Weitem der Nutzen.“
Bei aller Kritik: Es tut sich was. Mittlerweile gibt es die erste digitale deutsche Krankenversicherung. Virtual Reality kommt in der Psychotherapie zum Einsatz. Und erste intelligente Sprachsysteme, sogenannte Chatbots, ordnen mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Symptome ein. Die meisten Bürger sind demgegenüber aufgeschlossen: 81 Prozent befürworten laut einer Umfrage den Einsatz von KI zur Früherkennung von Krankheiten.
Gesundheitsapps fürs Smartphone nutzt fast jeder Zweite: Sportler zählen Schritte, Hypertoniker lassen sich den Verlauf ihres Blutdrucks anzeigen und Patienten mit Multipler Sklerose führen digital Tagebuch. Die Anwendungen sind praktisch – doch sind sie seriös? Bonner Wissenschaftler, die elf Blutdruck-Apps verglichen haben, kommen zu dem Schluss: „Die Apps haben das Potenzial, die Versorgung zu verbessern. Jedoch müssen sie hinsichtlich ihrer Funktion überprüft werden.“ Das bedeutet: Es ist noch Luft nach oben.
Weil der Markt undurchsichtig ist – schon 2016 konnten Nutzer mehr als 100.000 Gesundheitsapps herunterladen – hat Marcel Weigand vor drei Jahren eine Arbeitsgruppe speziell für solche Anwendungen ins Leben gerufen. Der Generalsekretär des Aktionsbündnisses Patientensicherheit erklärt: „Wir wollten den Nutzern Orientierung bieten.“
Heraus kam eine Checkliste, die einzuordnen helfen soll, ob eine App seriös ist (siehe Kasten). Der Anwendungsbereich, etwa die Erinnerung an die Tabletteneinnahme, muss eindeutig sein, ebenso sollte eine App mindestens alle sechs Monate aktualisiert werden. Sie darf keine abschließende Diagnose stellen und die Therapie lediglich unterstützen. Im Idealfall haben andere Nutzer die Anwendung positiv bewertet, zudem trägt sie ein vertrauenswürdiges Siegel und offenbart ihre Finanzierung. Bleibt unklar, was mit den Daten geschieht, oder kann der Nutzer diese nicht selbst wieder löschen, ist eine App nicht seriös.
Eine kostenfreie Anwendung muss dagegen nicht fragwürdig sein, beruhigt Weigand: „Es ist nicht verwerflich, wenn sich eine App durch Werbung finanziert. Diese sollte nur klar vom Inhalt getrennt sein.“ Außerdem, so der Experte, biete jede seriöse App eine Möglichkeit, den Betreiber zu kontaktieren.
Patienten, die angesichts der digitalen Neuerungen besorgt sind, rät Weigand, „sich möglichst selbst zu informieren und im Digitalen fit zu machen“. Da seien Politik und Krankenkassen gefragt: „Wir brauchen Kurse zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz. Ob bei einer Smartphone-Anwendung der Nutzen den Schaden überwiegt, muss dann jeder für sich selbst entscheiden.“
APP-CHECK
Sie nutzen eine Gesundheitsapp auf Ihrem
Smartphone oder möchten eine herunterladen?
Prüfen Sie sie mit der Checkliste vom Aktionsbündnis
Patientensicherheit:
www.aps-ev.de/app-checkliste/