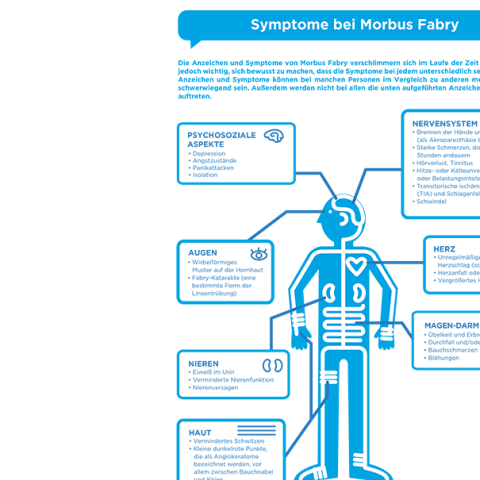Wird es in Deutschland geboren, hat ein weibliches Baby heute eine Lebenserwartung von bis zu 81 Jahren. Ein neugeborener Junge wird etwa 75 Jahre alt. Frauen leben damit im Schnitt bis zu sechs Jahre länger als Männer. Dafür gebe es gleich mehrere mögliche Gründe, sagt Professor Vera Regitz-Zagrosek in einem Interview mit dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie: „Frauen haben zum Teil eine günstigere Biologie und zum anderen einen schonenderen Umgang mit sich selbst.“ Schon Zellkulturen zeigen, dass weibliche Zellen im Vergleich zu männlichen weniger empfindlich auf Stress durch Hitze oder Sauerstoffmangel reagieren. Bestimmt werden die Unterschiede zwischen Männern und Frauen letztlich durch die genetischen Informationen auf den XX beziehungsweise XY Chromosomen. Auch bei etlichen Labortierstämmen leben die Weibchen länger als die Männchen. „Das hat mit zellulären Mechanismen zu tun, mit dem Schutz der Chromosomen-enden, der Telomere, mit besserer Mitochondrienfunktion, mit geringerer Produktion freier Radikale unter Stress“, erklärt Regitz-Zagrosek. Die Kardiologin ist Leiterin des Berliner Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité. Neben den rein biologischen Ursachen dürften soziokulturelle Ursachen jedoch nicht unterschätzt werden. „Ein weiterer Grund dafür, dass Männer kürzer leben, könnte auch darin liegen, dass sie in unserer Gesellschaft mehr Stress haben oder sich mehr Stress machen“, sagt Vera Regitz-Zagrosek.
Die Gendermedizin, auf die sie sich spezialisiert hat, ist eine relativ junge Fachdisziplin. Bis in die neunziger Jahre hinein wurden die Geschlechter noch weitgehend gleich behandelt. Dass dies aufgrund unterschiedlicher körperlicher Voraussetzungen mitunter sogar zu tödlichen Fehlern führen kann, hat sich inzwischen vor allem auch bei der Diagnose von Herz-Kreislauferkrankungen gezeigt. Nur 50 Prozent der betroffenen Frauen überleben ihren ersten Herzinfarkt. Bei den Männern sind es 70 Prozent. Neben starkem Brustschmerz spüren Frauen oft Übelkeit, Schmerzen in Hals und Kiefer oder im Arm sowie im Rücken. Ihre Symptome sind diffuser als die der Männer. Herz-Patientinnen erhalten dadurch oft nicht die Behandlung, die sie bräuchten, um zu überleben.
Doch auch viele andere Erkrankungen äußern sich bei den Geschlechtern unterschiedlich. Durch ihre geringere Knochendichte können Frauen beispielsweise wesentlich früher an Knochenschwund leiden als Männer, die es im Schnitt erst 10 Jahre später trifft. Andererseits sorgt eine höhere Anzahl weißer Blutkörperchen für eine bessere Immunabwehr.
Schon 2001 wies das amerikanische Institute of Medicine darauf hin, dass „Volksleiden“ wie Rheuma, Osteoporose, Depression oder Herz-Kreislauf-Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen. Die Wissenschaftler kritisierten, dass Gender-Unterschiede hier nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Alexandra Kautzky-Willer, erste Professorin für Gender Medizin in Österreich, erklärt die lange Blindheit für geschlechterspezifische Unterschiede aus der Medizingeschichte. „Wissenschaftliche Untersuchungen fanden früher primär am Mann statt, Prototyp männlich, weiß, mittleren Alters. Die Forschung hat Frauen ausgeschlossen“, kritisiert die Wissenschaftlerin gegenüber der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“. Bei Medikamententests sollten im Falle einer unbemerkten Schwangerschaft Auswirkungen auf das Kind verhindert werden. Auch heute liegen zur Wirkung von Medikamenten auf den weiblichen Organismus noch zu wenige Erkenntnisse vor. Dabei sind die Reaktionen auf Medikamente häufig geschlechtsspezifisch. Nebenwirkungen treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Je nach Medikament baut die weibliche Leber die darin enthaltenen Substanzen auf Grund bestimmter Enzyme entweder langsamer oder schneller ab als die männliche. Zudem erleichtert der höhere Körperfettanteil bei Frauen die Einlagerung fettlöslicher Arzneisubstanzen. Ihr langsameres Verdauungssystem sorgt dafür, dass Wirkstoffe länger im Körper bleiben und dadurch ebenfalls stärker wirken. „Zu beachten ist außerdem, dass die Nierenfunktion, vor allem bei körperlich kleineren alten Frauen in der Regel noch stärker abnimmt, als bei alten Männern“, sagt Vera Regitz-Zagrosek.
»Nur 50 Prozent der Frauen überleben ihren ersten Herzinfarkt.«
Nicht zuletzt können Östrogene die Wirkung von Medikamenten beeinflussen. Sie sind mit der Pubertät maßgeblich für die Entwicklung des weiblichen Körpers verantwortlich, für die monatliche Periode ebenso wie für körperliche Veränderungen während der Schwangerschaft. Lässt die Östrogenproduktion mit den Wechseljahren schließlich nach, endet die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau. Außerdem verändert sich die Haut. Der Fettstoffwechsel verlangsamt sich. Symptome wie Hitzewallungen, Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen können hinzukommen. Im Vergleich dazu nimmt die Testosteronproduktion beim Mann ab 40 langsam ab, jährlich etwa um 1,2 Prozent. Entsprechend langsamer vollziehen sich begleitende psychische und körperliche Veränderungen.
Geschlechterspezifische Gesundheitsrisiken ergeben sich dennoch nicht allein aus den biologischen Unterschieden. Eine wichtige Rolle spielt der Lebensstil, der bei Männern als risikoreicher eingestuft wird. Beispielsweise trinken rund 42 Prozent zu viel Alkohol, bei den Frauen sind es 26 Prozent. Männer konsumieren zudem deutlich mehr Fast Food und Fett. Die Folgen bleiben nicht aus: 60 Prozent der Männer in Deutschland sind nach Angaben des statistischen Bundesamtes zufolge übergewichtig. Bei den Frauen sind es 43 Prozent. Außerdem nehmen die Geschlechter Präventionsangebote unterschiedlich wahr. Nach Angaben des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI) gehen nur rund 27 Prozent der Männer regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. Bei den Frauen sind es immerhin rund 48 Prozent. „Beide Geschlechter profitieren, wenn ihre Unterschiede wahrgenommen, wenn sie adäquat angesprochen und Präventionsangebote sowie Therapiemaßnahmen auf sie abgestimmt werden“, fordert die Deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin.