Wäre der deutsche Mittelstand ein Mensch, handelte es sich um eine Person mit widersprüchlichen Charaktereigenschaften: stark, stolz und selbstbewusst, der Rückhalt der Familie – aber auch schnell kränkelnd und mit einer Neigung zum Pessimismus.
Wie lässt sich dieses Persönlichkeitsprofil erhärten oder differenzieren? Wie geht es dem Mittelstand heute, was will er? Vor welchen Herausforderungen steht er? Und worin ist der Mittelstand richtig gut?
Auf jeden Fall kann er mit einigen Pfunden wuchern: Im Jahr 2022 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 35,7 Millionen Personen abhängig beschäftigt. Mehr als die Hälfte von ihnen, 19,1 Millionen, arbeiteten im Mittelstand, genauer gesagt in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU, zur Definition siehe Kasten). Unverzichtbar sind diese Menschen vor allem im Bau- und Gastgewerbe, dort sind 87 Prozent aller tätigen Personen bei KMU beschäftigt. In der Baubranche erzielten diese Firmen außerdem rund 76 Prozent des Gesamtumsatzes, im Gastgewerbe sogar 88 Prozent.
Noch beeindruckender sind die Zahlen zur Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen: 96,6 Prozent der exportierenden Unternehmen sind KMU, sagt der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und beziffert deren Exportumsatz für 2022 auf 227,7 Milliarden Euro. Ebenso vom BVMW stammt die Angabe, dass der Mittelstand in diesem Zeitraum für 49,3 Prozent der Nettowertschöpfung des Landes verantwortlich war.
Doch all diese Fakten verblassen im Vergleich mit dem größten Beitrag des Mittelstandes: Er macht die Zukunft möglich – 90 Prozent aller Auszubildenden erlernen ihren Beruf bei KMU. Diese Leistung können die Unternehmen allerdings nur erbringen, wenn sie ihre Ausbildungsplätze besetzen können. Und das klappt schon seit so langer Zeit nicht mehr, dass die jährliche ernüchternde Bestandsaufnahme zum Herbst gehört wie Schietwetter in Hamburg.
In seinem jüngsten Berufsbildungsbericht kommt das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf 73.400 Ausbildungsplätze, die im Jahr 2023 vakant blieben. Außerdem brechen viele Azubis ihre Ausbildung ab: 2022 wurden 29,5 Prozent aller Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst. Jungen Menschen, so der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB), fehle es häufig schon an einer „rudimentären Berufsvorstellung“. Als präventive Maßnahme schlägt DMB-Vorstand Marc S. Tenbieg eine Neugestaltung der Berufsorientierung in der Schule vor: „Die duale Ausbildung muss frühzeitig und mehr denn je als gleichwertige Alternative zum Studium vermittelt werden.“
Doch nicht nur der ausbleibende Nachwuchs bereitet dem Mittelstand Sorgen, es ist der Fachkräftemangel insgesamt. In einer auf das Jahr 2023 bezogenen Umfrage unter KMU gaben laut Statista 39,5 Prozent an, nicht für alle offenen Stellen geeignete Arbeitskräfte zu finden, bei knapp der Hälfte hielten sich Erfolg und Fehlschläge die Waage. Eine Befragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY unter 800 Mittelständlern im November 2021 ergab, dass 67 Prozent den Fachkräftemangel als die größte Gefahr für die Entwicklung ihres Unternehmens betrachten.
Durch fehlendes qualifiziertes Personal entgingen der Wirtschaft jährlich zweistellige Milliardenbeträge, sagt der BVMW. Besonders KMU litten unter diesem Engpass. „Mit dem Rücken zur Wand“ sieht BVMW-Sprecher Hagen Wolfstetter die Unternehmen, der Fachkräftemangel sei „längst ein strukturelles Problem“. Er fordert: „Es ist höchste Zeit, dass die Politik handelt und nicht nur über mögliche Lösungen diskutiert.“
Wie diese Lösungen aussehen könnten, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im November dieses Jahres skizziert: Unter anderem müssten die Fachkräftezuwanderung intensiviert, der Renteneintritt hinausgezögert und die Arbeitszeiten modernisiert werden. Der BVMW fordert mehr Investitionen in Bildung und Weiterbildung, der DMB möchte die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen und die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss reduzieren.
Und was können die Unternehmen selbst tun, um als Arbeitgeber attraktiv zu werden und zu bleiben, um Menschen für sich zu gewinnen? Der Outdoor-Ausrüster Vaude aus Tettnang beispielsweise positioniert sich als Unternehmen mit Verantwortung für Menschen und den Planeten, setzt sich kritisch mit den Herstellungsbedingungen der eigenen Produkte auseinander, die Firmenchefin und Inhaberin Antje von Dewitz engagiert sich energisch politisch-gesellschaftlich für Demokratie, Gleichberechtigung und Umweltschutz. Die Frauenquote der Führungskräfte liegt bei 44 Prozent, Beschäftigte demonstrieren gemeinsam bei „Fridays for Future“, es gibt ein interaktives Ideenmanagement und ein Kultur-Board, ein Sport- und Gesundheitsprogramm sowie Ausund Weiterbildungskurse. 2024 hat Vaude bereits zum zweiten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen – und mit dem authentischen alternativen Unternehmensentwurf gewinnt Vaude Menschen, die sich mit der Philosophie der Firma am Bodensee identifizieren: Laut dem aktuellen Vaude-Nachhaltigkeitsbericht gingen 2023 mehr als 160 Initiativbewerbungen ein, jedes Jahr beginnen zehn bis zwölf Azubis ihre Ausbildung beim Outdoor-Spezialisten, der den Nachwuchs anschließend in der Regel übernimmt. So viel Verlässlichkeit wird belohnt: Die Fluktuationsrate bei Vaude beträgt gerade einmal 5,08 Prozent – der Bundesdurchschnitt über alle Branchen hinweg liegt bei rund 30 Prozent, so die Bundesagentur für Arbeit.
Personalprobleme sind jedoch nur ein Steinchen des Mosaiks aus Herausforderungen, denen der Mittelstand heute begegnen muss.
Das Gesamtbild setzt sich ebenso aus Dauerthemen wie der Digitalisierung oder der weltweit dringenden Notwendigkeit zur Abkehr von fossilen Energieträgern zusammen.
Der Pessimismus der KMU, unter diesen Bedingungen in Zukunft gute Geschäfte zu machen, ist ausgeprägt, das spiegelt das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer wider, das monatlich das Geschäftsklima misst. Im September lag der Wert bei -19,4 Punkten – übersetzt heißt das: Gegenwart und Zukunft erscheinen den rund 9.000 befragten Firmen dunkelgrau.
Strahlt die Sonne des Erfolgs noch irgendwo? Ja, sagen die Experten der Strategieberatung Munich Strategy, die jährlich in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt die 100 wachstumsstärksten Mittelständler des Landes ermittelt. Auf Platz eins liegt in diesem Jahr der IT-Dienstleister Init, der seinen Umsatz zwischen 2019 und dem Geschäftsjahr 2022/2023 um 44,1 Prozent auf knapp 182 Millionen Euro steigern konnte.
Init berät Institutionen der öffentlichen Hand sowie Firmen in Sachen digitale Transformation. Mit dieser Aufgabe fremdeln viele Organisationen der Zielgruppe und brauchen einen kompetenten Partner.
So entwickelt Init beispielsweise für Verwaltungen digitale Lösungen, unter anderem eine Plattform, auf der Bürger Ideen für ihre Stadt einstellen können, Politik und Behörden haben die Möglichkeit, mit der Bevölkerung digital in Kontakt zu treten.
Fast alle Firmen, die im Ranking von Munich Strategy auf den vorderen Plätzen stehen, sind weit überdurchschnittlich innovativ. Noch-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte auf dem Innovationstag Mittelstand im Juni: „Innovationen sind Antworten auf große und kleine Herausforderungen und Türöffner für unsere Zukunft. Für uns in Deutschland sind dabei die Kreativität, Leistungsfähigkeit und Schaffenskraft des Mittelstands besonders wichtig.“
Das mag ein Ansporn sein. Denn die gepriesene Schaffenskraft lässt noch zu wünschen übrig: Laut dem KfW-Innovationsbericht 2023 haben im Zeitraum zwischen 2019 und 2021 nur vier von zehn KMU mindestens eine Innovation hervorgebracht – die entsprechende Innovatorenquote ist gegenüber der vorherigen Messperiode auf 40 Prozent gesunken.

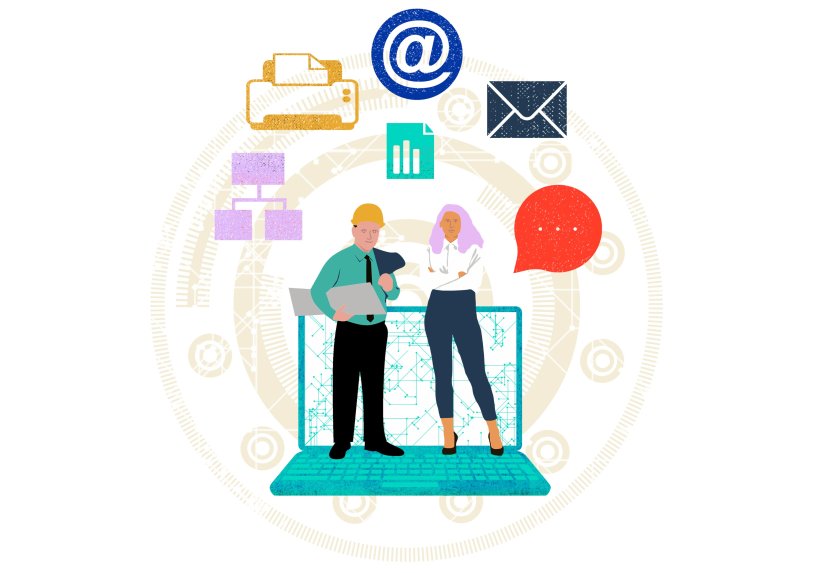

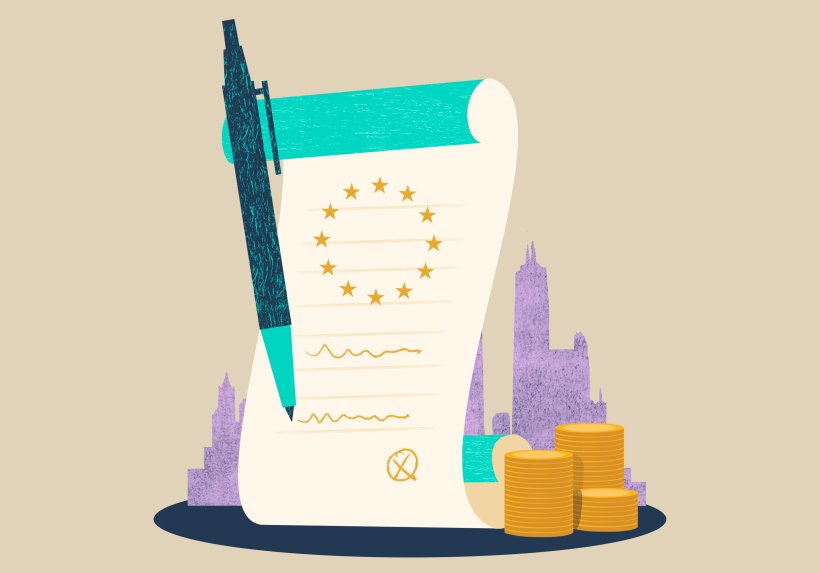
WER SIND DIE EIGENTLICH?
Wann immer in Medien, Vorträgen oder Diskussionen vom deutschen Mittelstand die Rede ist, glauben die meisten zu wissen, was das ist: ungefähr alle Firmen außer Konzernen. Und diese Einschätzung trifft es ziemlich gut, wenn man den Mittelstand gleichsetzt mit der Gesamtheit aller kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), denn diese Gruppe umfasst laut Statista 99,3 Prozent aller Firmen hierzulande, in absoluten Zahlen sind das 3,1 Millionen.
Es gibt verschiedene Definitionen von KMU, im Allgemeinen jedoch richten sich Statistiken nach der Empfehlung der EU-Kommission. Die Einordnung berücksichtigt in erster Linie die Zahl der Mitarbeitenden und den Umsatz beziehungsweise die Bilanzsumme, ebenso aber spielen die Besitzverhältnisse eine Rolle.
Der Definition zufolge gehören zu den KMU zum einen Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz oder einer Bilanzsumme von maximal zwei Millionen Euro.
Zum zweiten gibt es kleine Unternehmen, sie haben nicht mehr als 49 Mitarbeitende, Jahresumsatz oder Bilanzsumme liegen bei höchstens zehn Millionen. Die dritte Untereinheit sind mittlere Unternehmen, die maximal 249 Menschen beschäftigen und pro Jahr höchstens 50 Millionen Euro umsetzen respektive eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro aufweisen.
In Deutschland sieht die Sache ein bisschen komplizierter aus, denn der Begriff „Mittelstand“ orientiert sich hier weniger an nackten Zahlen. Zwar wird die große Mehrheit der mittelständischen Unternehmen zu den KMU gerechnet, doch darüber hinaus fallen Eigentums- und Leitungsverhältnisse stärker ins Gewicht. Insbesondere im Falle von Firmen in Familienhand, aber nicht nur dort, üben bei einem Mittelständler Unternehmerin oder Unternehmer selbst Einfluss aus, tragen das unternehmerische Risiko und bestreiten aus dem Geschäft meistens auch ihren Lebensunterhalt.
Personalprobleme sind jedoch nur ein Steinchen des Mosaiks aus Herausforderungen, denen der Mittelstand heute begegnen muss.
Das Gesamtbild setzt sich ebenso aus Dauerthemen wie der Digitalisierung oder der weltweit dringenden Notwendigkeit zur Abkehr von fossilen Energieträgern zusammen.
Der Pessimismus der KMU, unter diesen Bedingungen in Zukunft gute Geschäfte zu machen, ist ausgeprägt, das spiegelt das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer wider, das monatlich das Geschäftsklima misst. Im September lag der Wert bei -19,4 Punkten – übersetzt heißt das: Gegenwart und Zukunft erscheinen den rund 9.000 befragten Firmen dunkelgrau.
Strahlt die Sonne des Erfolgs noch irgendwo? Ja, sagen die Experten der Strategieberatung Munich Strategy, die jährlich in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt die 100 wachstumsstärksten Mittelständler des Landes ermittelt. Auf Platz eins liegt in diesem Jahr der IT-Dienstleister Init, der seinen Umsatz zwischen 2019 und dem Geschäftsjahr 2022/2023 um 44,1 Prozent auf knapp 182 Millionen Euro steigern konnte.
Init berät Institutionen der öffentlichen Hand sowie Firmen in Sachen digitale Transformation. Mit dieser Aufgabe fremdeln viele Organisationen der Zielgruppe und brauchen einen kompetenten Partner.
So entwickelt Init beispielsweise für Verwaltungen digitale Lösungen, unter anderem eine Plattform, auf der Bürger Ideen für ihre Stadt einstellen können, Politik und Behörden haben die Möglichkeit, mit der Bevölkerung digital in Kontakt zu treten.
Fast alle Firmen, die im Ranking von Munich Strategy auf den vorderen Plätzen stehen, sind weit überdurchschnittlich innovativ. Noch-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte auf dem Innovationstag Mittelstand im Juni: „Innovationen sind Antworten auf große und kleine Herausforderungen und Türöffner für unsere Zukunft. Für uns in Deutschland sind dabei die Kreativität, Leistungsfähigkeit und Schaffenskraft des Mittelstands besonders wichtig.“
Das mag ein Ansporn sein. Denn die gepriesene Schaffenskraft lässt noch zu wünschen übrig: Laut dem KfW-Innovationsbericht 2023 haben im Zeitraum zwischen 2019 und 2021 nur vier von zehn KMU mindestens eine Innovation hervorgebracht – die entsprechende Innovatorenquote ist gegenüber der vorherigen Messperiode auf 40 Prozent gesunken.
WER SIND DIE EIGENTLICH?
Wann immer in Medien, Vorträgen oder Diskussionen vom deutschen Mittelstand die Rede ist, glauben die meisten zu wissen, was das ist: ungefähr alle Firmen außer Konzernen. Und diese Einschätzung trifft es ziemlich gut, wenn man den Mittelstand gleichsetzt mit der Gesamtheit aller kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), denn diese Gruppe umfasst laut Statista 99,3 Prozent aller Firmen hierzulande, in absoluten Zahlen sind das 3,1 Millionen.
Es gibt verschiedene Definitionen von KMU, im Allgemeinen jedoch richten sich Statistiken nach der Empfehlung der EU-Kommission. Die Einordnung berücksichtigt in erster Linie die Zahl der Mitarbeitenden und den Umsatz beziehungsweise die Bilanzsumme, ebenso aber spielen die Besitzverhältnisse eine Rolle.
Der Definition zufolge gehören zu den KMU zum einen Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz oder einer Bilanzsumme von maximal zwei Millionen Euro.
Zum zweiten gibt es kleine Unternehmen, sie haben nicht mehr als 49 Mitarbeitende, Jahresumsatz oder Bilanzsumme liegen bei höchstens zehn Millionen. Die dritte Untereinheit sind mittlere Unternehmen, die maximal 249 Menschen beschäftigen und pro Jahr höchstens 50 Millionen Euro umsetzen respektive eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro aufweisen.
In Deutschland sieht die Sache ein bisschen komplizierter aus, denn der Begriff „Mittelstand“ orientiert sich hier weniger an nackten Zahlen. Zwar wird die große Mehrheit der mittelständischen Unternehmen zu den KMU gerechnet, doch darüber hinaus fallen Eigentums- und Leitungsverhältnisse stärker ins Gewicht. Insbesondere im Falle von Firmen in Familienhand, aber nicht nur dort, üben bei einem Mittelständler Unternehmerin oder Unternehmer selbst Einfluss aus, tragen das unternehmerische Risiko und bestreiten aus dem Geschäft meistens auch ihren Lebensunterhalt.



