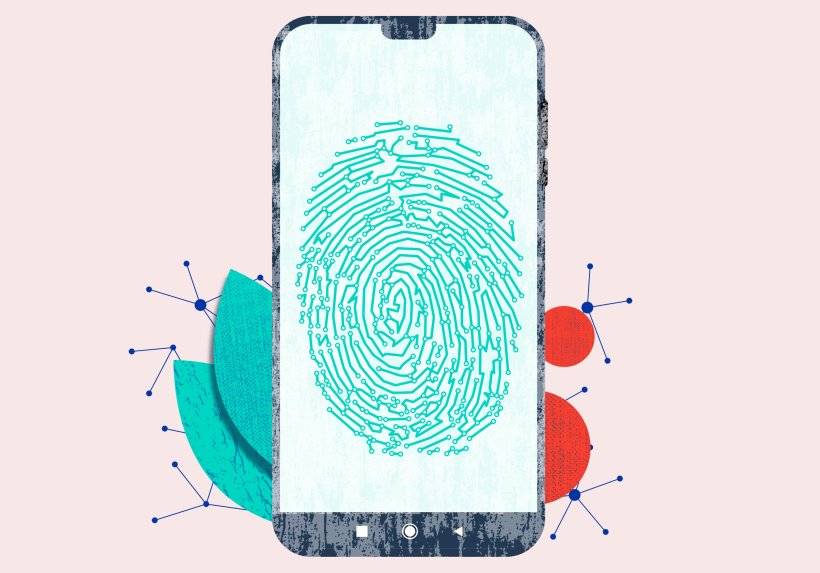Künstliche Intelligenz (KI) hat sich mittlerweile zu einer unverzichtbaren Schlüsseltechnologie entwickelt. Ob in der Industrie, im Handel oder im Alltag – KI macht Prozesse effizienter und das Leben intelligenter. Doch diese technologische Revolution hat ihren Preis: KI könnte sich als enormer Energiefresser entpuppen.
Dabei ist nicht bekannt, wieviel Strom ChatGPT oder andere Systeme verbrauchen. Ableiten lässt sich das vielleicht von klassischen Suchanfragen bei Google. Experten schätzen, dass die täglich neun Milliarden Google-Suchanfragen bereits so viel Energie verbrauchen wie ganz Irland im Jahr. Dazu kommen die damit verbundenen CO2-Emissionen: Eine Google-Suchanfrage verursacht etwa 1,5 Gramm CO2, während eine Anfrage an ChatGPT geschätzt sogar 4,5 Gramm CO2 ausstößt – möglicherweise auch das Doppelte oder Dreifache. Eine Studie des Halbleiterherstellers AMD warnt: Sollte das Wachstum im Bereich KI ungebremst weitergehen, könnte ab 2047 die gesamte weltweit produzierte Energie für KI-Systeme benötigt werden. „Werkzeuge der KI verbrauchen viel Strom, und die Tendenz ist steigend“, erklärt Ralf Herbrich vom Hasso-Plattner-Institut gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Allein das Training eines einzigen KI-Modells ist ein hochkomplexer, energieintensiver Prozess. Um diesem Szenario entgegenzuwirken, verfolgen KI-Anbieter zwei Strategien.
MEHR EFFIZIENZ
Zum einen, indem sie KI-Modelle energieeffizienter gestalten. Große Anbieter wie Google arbeiten an Algorithmen, die mit weniger Parametern auskommen und dabei nur minimal an Prognosequalität verlieren. Zudem berichtet Google, dass der Energiebedarf für den KI-Betrieb langsamer wächst als ursprünglich angenommen. Durch optimierte Verfahren soll der Energieverbrauch beim Modelltraining deutlich gesenkt werden. Zum anderen setzen sie auf eine nachhaltige Stromversorgung. Schon heute sind Rechenzentren gesetzlich verpflichtet, ihren Energiebedarf zu einem bestimmten Anteil aus erneuerbaren Quellen zu decken. Ab 2027 müssen größere Zentren in Deutschland zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien zurückgreifen.
NACHHALTIGE STROMERZEUGUNG
In den USA dagegen plant Microsoft, das vor fünf Jahren stillgelegte Atomkraftwerk Three Mile Island wieder in Betrieb zu nehmen, um damit seine Rechenzentren zu versorgen. Auch der europäische Betreiber NorthC verfolgt ehrgeizige Ziele und setzt in Groningen auf Strom aus Brennstoffzellen und grünem Wasserstoff. Langfristig könnten sogar die Notstromgeneratoren CO2-neutral gestaltet werden.
KI-GESTÜTZTES ENERGIEMANAGEMENT
Einen ganz anderen Weg geht Siemens: 2022 eröffnete das Unternehmen ein hochmodernes Rechenzentrum in Tallinn. Die Anlage wird mit erneuerbarem Strom betrieben und profitiert vom kühlen Klima Estlands, das energieintensive Kühlsysteme überflüssig macht. KI kommt dabei nicht nur als Verbraucher, sondern auch als Optimierer zum Einsatz: Intelligente Algorithmen berechnen den Kühlbedarf im Voraus und steigern so die Effizienz der Anlage um bis zu 30 Prozent. Das System lernt kontinuierlich dazu und passt sich dynamisch an neue Anforderungen an. So könnte Künstliche Intelligenz wirklich zum Hoffnungsträger werden – und nicht zum ökologischen Flop.