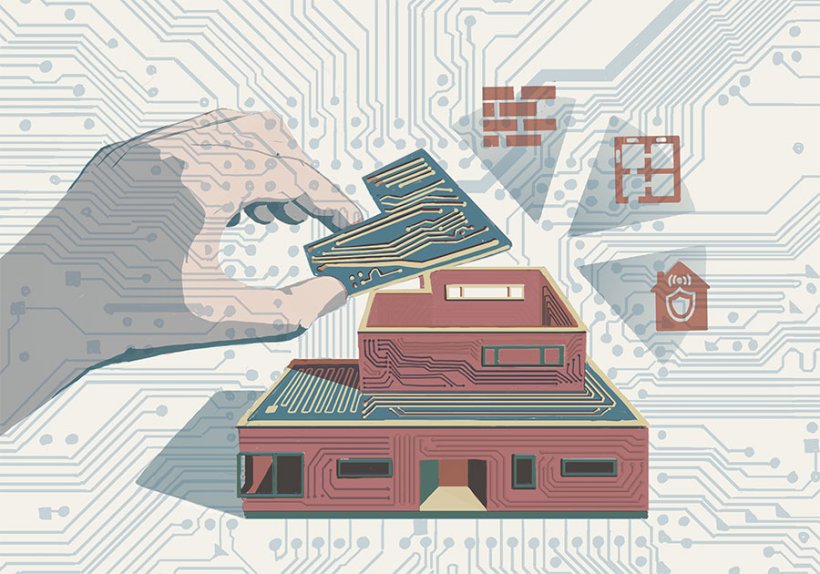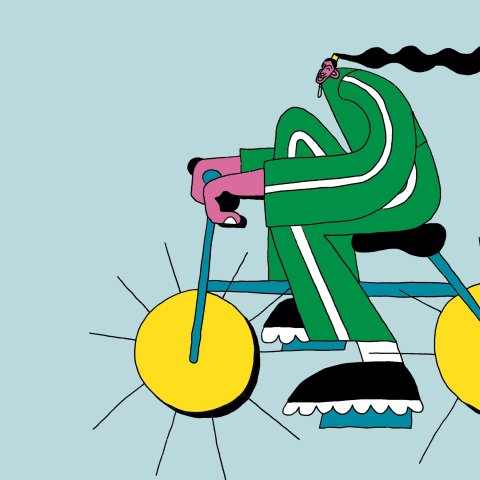„Halleluja Berlin“, sang vor gut 13 Jahren Rainald Grebe, „alle wollen da hin, deshalb will ich das auch“. Ein enormer Drang in die Städte macht sich mittlerweile flächendeckend bemerkbar. In den wirtschaftsstarken Metropolen steigen mit der Nachfrage die Preise fürs Wohnen rasant. Nachdem sich der Spötter mit seinem Lied „Brandenburg“ über das Umland der Hauptstadt lustig gemacht hatte, ist er übrigens in die Uckermark gezogen. Aber auch auf dem Land ist das mit dem Wohnen so eine Sache: Versiegelung und Zersiedelung soll aus ökologischen Gründen möglichst vermieden werden. Und die Baukosten steigen ohnehin, egal wo. Zu den Ursachen zählen nicht zuletzt zunehmend strenge Reglements, neue Umweltstandards etwa sollen den hohen Energiebedarf unserer Wohngebäude und unnötige Emissionen minimieren. Die Baubranche wird mit einem schnellen und weitreichenden Wandel konfrontiert. Zugleich werden einige Trends sichtbar, die Lösungen versprechen.
Dass weniger mehr ist, wissen wir schon seit Mies van der Rohe. Dieser Ausspruch des Bauhaus-Architekten wird nun allerdings besonders konsequent umgesetzt: in Form sogenannter „Tiny-Houses“, englisch für besonders kleine Häuser. Im vergangenen Jahr hat der Versandhändler Tchibo solche Minihaus-Modelle für kurze Zeit im Sortiment gehabt. Auch das estnische Designunternehmen Kodasema hat eines entwickelt. Mit einer Fläche von 25 Quadratmetern soll es 48.200 Euro kosten und an nur einem Tag aufgebaut sein. Solche Häuser lassen sich im Falle eines Umzugs sogar mitnehmen.
Kleiner, aber feiner bauen
Der ökologische Pluspunkt bei solch einem Konzept: Je weniger Fläche und Baumasse benötigt werden, umso geringer sind Materialaufwand, Energieverbrauch und damit die Umweltbelastung. Im Sinne dieser Suffizienz und Nachhaltigkeit befürwortet der Verband Privater Bauherren (VPB) kleinere Häuser – verweist aber zugleich auf ökonomische Aspekte, die es zu beachten gelte: „Ob der Kauf eines vorfabrizierten Moduls der gehobenen Preisklasse die Lösung ist, bleibt ein Rechenexempel. Manche Bauherren fahren sicher besser, wenn sie sich ein kleines Haus für ihre individuellen Bedürfnisse und passend zum Grundstück vom freien Architekten planen lassen.“
Wer keine potenziell mobile Immobilie benötigt und stattdessen ein paar Quadratmeter mehr haben möchte, muss nicht auf Flexibilität verzichten. Zum Prinzip Nachhaltigkeit zählt für Architekten heutzutage auch, den Lebenszyklus der Bewohner bei der Planung eines Gebäudes zu berücksichtigen. Wir werden schließlich alle immer älter. Eine flexible Grundrissstruktur kann zahlreiche Szenarien für spätere (kleine) Umbauten und Umnutzungen ermöglichen: Zunächst belebt etwa eine Familie mit drei Kindern den Wohnraum und die Nutzflächen im Untergeschoss. In einigen Jahrzehnten könnte man solch ein flexibles Haus mit einfachen Mitteln in zwei Wohnungen teilen. Auf tragende Wände sollten die Bauherren hierfür im Innenbereich möglichst verzichten. Die intelligente Platzierung von Fallrohren und Versorgungsleitungen ermöglicht eine variable Platzierung von Küchen und Bädern. Den nötigen Spielraum schafft auch die intelligente Positionierung von Treppen.
Solche Konzepte gehören nicht nur im hochwertigen Eigenheimbau mittlerweile zum Standard. Auch das Baukonzept „Kieler Modell“ liefert hier Lösungsansätze. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Arbeits- und Planungshilfe für moderne Typenhäuser, die in dezentraler Lage als Gemeinschaftsunterkünfte genutzt werden können. Ihr Vorteil liegt in der schnellen Umsetzbarkeit: Schon komplett im Rastermaß geplant und fertig berechnet, müssen praktisch nur noch Flächen für die Errichtung freigegeben werden. Länder, Städte und Kommunen erhalten damit die Möglichkeit eine große Anzahl Menschen unterzubringen.
Modulares Bauen
Um die enorme Nachfrage nach Wohnraum in den urbanen Zentren bedienen zu können, sind allerdings noch ganz andere Mittel gefragt – durch modulares Bauen. Unter anderem gehen hier die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Berlins voran. Zusammen mit der Politik haben sie das Ziel formuliert, ihren Bestand durch Neubau und Erwerb von derzeit rund 300.000 auf 400.000 Wohnungen im Jahr 2026 zu erhöhen. Um im Neubau bezahlbare Mieten offerieren zu können, setzen die Landeseigenen auf Typenbau: Häuser, die nach dem gleichen Entwurf mehrfach in gleicher Weise errichtet werden. Dafür wurden Studien und Wettbewerbe in Auftrag gegeben. 2017 stellten sie erstmals ihre „Neuen Typen“ vor. „Die Vorteile liegen auf der Hand“, sagt Snezana Michaelis, Mitglied des Gewobag-Vorstandes. „Standardisierung und Typisierung von Entwurfselementen und Bauteilen können Planungs- und Bauzeiten verkürzen, die Produktion hoher Stückzahlen kann die Herstellungskosten reduzieren.“
Die Überlegungen der Wohnungsbaugesellschaften gehen in zwei grundsätzlich unterschiedliche Richtungen für neue Typenbauten und für das serielle Bauen: „Einerseits werden Typen vorgeschlagen, die auf modularen Grundrissanordnungen basieren. Diese sind losgelöst von der Nutzung industrieller Methoden gedacht und können bewusst auch in konventioneller Bauweise – Ziegel, Mauerwerk oder Beton – errichtet werden“, so Michaelis. „Andererseits werden auf neuen Systemen basierende Häuser mit hohem Vorfertigungsgrad, Hybridtechnologien oder mit Modulanteil vorgeschlagen.“ Sie stellen neue Anforderungen an die am Planungs- und Bauprozess Beteiligten und bedingen veränderte Planungs- und Arbeitsprozesse im Wohnungsbau. Serielles Bauen wird heute einerseits mit den Trabantenstädten aus den 1960er- und 1970er-Jahren verbunden. Mit den „Neuen Typen“ sollen zwar ebenfalls komplette Quartiere neu entstehen, jedoch nicht in den Ausmaßen wie seinerzeit. Und nicht zuletzt geht es auch um die Verdichtung der bestehenden Stadt, die Ergänzung vorhandener Strukturen.
Fertighäuser sind im Kommen
Hierbei lohnt sich auch ein Blick in die andere Richtung: Im Segment Fertighaus wurde kosteneffizientes Bauen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich vorangebracht. Dass diese Art des Bauens derzeit eine Renaissance erlebt, hat seinen Grund auch in der Digitalisierung, die in der Fertigung neue Wege eröffnet. In der Vergangenheit konnten lediglich baugleiche Elemente zu einem System zusammengefügt werden, wenn das Verfahren preisgünstig sein sollte. Heute dagegen ist es möglich, weitgehend kostenneutral komplexe Systeme aus individuell gefertigten, unterschiedlich geformten Modulen zu erzeugen. Mit Hilfe von digitalen Entwurfsprozessen und robotergesteuerten Herstellungsverfahren lassen sich so Häuser in Serie realisieren, die flexibel sind, also für unterschiedliche Einzelfälle Spielräume ermöglichen – und damit ebenfalls nachhaltig eingesetzt werden können.
Eine zentrale Rolle spielt die Digitalisierung auch beim Thema Energie. Die dezentrale Versorgung von Gebäuden muss den klassischen Wohnungsbau erreichen, um die Energiewende wirkungsvoll zu unterstützen. Leuchtturmprojekte in Passiv- und Plusenergiehäusern zeigen, wohin die Reise mittel- bis langfristig geht. Ein spürbarer Mehrwert wird vor allem mit der Masse erreicht. „Es müssen Konzepte entwickelt werden, mit denen Mieterstrom in Immobilien umgesetzt wird, die sich auch junge Familien leisten können“, sagt Florian Henle, Geschäftsführer des Ökoenergieversorgers und Mieterstromdienstleisters Polarstern. Neben technisch angepassten und intelligent vernetzten Energiekonzepten, gelte es dazu besonders die Prozesse zu optimieren.
Dann müssen nur noch die Dämmwerte stimmen, ohne dass der optische Eindruck beeinträchtigt wird. Wärmedämmverbundsysteme genießen hierbei nicht den besten Ruf, auch wenn sich solche Fassaden optisch durch Farben, Putze, Formteile und Materialkombinationen aufwerten lassen. Im Vergleich zu natürlichen Dämmstoffen wie Holzfasern, Kork, Hanf, Schilf oder Gras, aber auch verglichen mit Vakuum-Isolierpaneelen, sind Dämmplatten aus Polystyrol oder Polyurethan zwar günstig. Allerdings handelt es sich dabei um erdölbasierte Dämmstoffe, deren Herstellung selbst einiges an Energie verbraucht und deren spätere Entsorgung nicht ganz unproblematisch ist.
Völlig neue Wege geht man im Hamburger BIQ-Algenhaus: In dessen Bioreaktorfassade werden Einzeller kultiviert, die durch Photosynthese energieärmere Stoffe in energiereiche Materie umwandeln. Unter optimalen Bedingungen teilen sie sich zweimal am Tag, woraus neue Organismen zur Energieerzeugung entstehen. In einer Biogasanlage wird aus der in der Energiezentrale geernteten und dann getrockneten Biomasse Methan gewonnen, das sich als Heizgas oder zum Betrieb von Motoren verwenden lässt, während die erzeugte Wärme das Gebäude heizt.