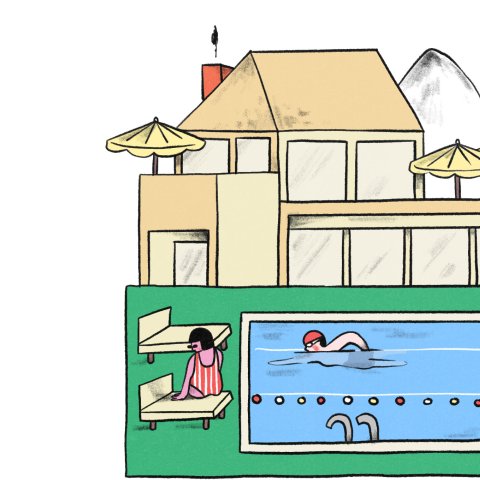Es begann mit schmerzhaften, entzündeten Knoten in der Achselhöhle. Am Anfang dachte Roland Reiser noch, die Akne, die ihn als Jugendlicher im Gesicht geplagt hatte, sei jetzt eben an anderer Stelle aufgetaucht. Sechs Monate ignorierte er die zunehmenden Schmerzen, obwohl sich die Pusteln öffneten, Flüssigkeit und Eiter austraten: „Ich habe nur noch dunkle T-Shirts getragen, damit das nicht so auffällt. Aber der Geruch war schlimm“, erinnert sich der heute 35-Jährige. Schließlich gestand sich Reiser ein: „Da stimmt was nicht!“. Ein Jahr nach dem ersten Auftreten der Symptome suchte er Hilfe in der Dermatologie eines Krankenhauses, wo man ihm – ohne Betäubung – die schmerzenden Stellen unter den Achseln entfernte. Das war 2016. Schon damals warnte ihn der behandelnde Arzt, sein Zustand sei chronisch. Ein weiteres halbes Jahr verging, die Entzündungen und die Schmerzen kehrten zurück, Reiser googelte seine Symptome – und der Dermatologe, den er aufsuchte, bestätigte seinen Verdacht: Reiser litt an Akne inversa, einer schwer behandelbaren chronische Hauterkrankung der Haarfollikel. Meist in Schüben bilden sich schmerzhafte und oft nässende Hautveränderungen vor allem unter den Achseln, der Leistengegend und im Analbereich. Und: Akne inversa ist eine Seltene Erkrankung.
FEHLENDES FACHWISSEN
Damit gehört Reiser zu den rund vier Millionen Menschen in Deutschland, die an einer Seltenen Erkrankung leiden. Als selten gilt eine Krankheit in der EU, wenn nicht mehr als einer von 2.000 Menschen von ihr betroffen ist. Schätzungen zufolge gibt es sechs- bis zehntausend Seltene Erkrankungen. Betroffene Organe und Körpersysteme, Symptome und Verlauf sind unterschiedlichster Natur. Es gibt jedoch einige Gemeinsamkeiten. Ein Großteil ist angeboren, also genetischen Ursprungs. Viele beginnen schon im Kindesalter. Oftmals sind sie lebensbedrohlich, chronisch und beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen erheblich. Vor allem aber: Selbst unter Fachleuten herrscht oft wenig Wissen um diese Krankheiten. Das führt dazu, dass eine Diagnosestellung oft langwierig ist. Die Betroffenen und ihr Umfeld sind in dieser Zeit häufig mit Unsicherheiten, Fehlbehandlungen und einer erheblichen Belastung konfrontiert – zumal auch oft kaum Therapien verfügbar sind. Nicht umsonst heißen sie im Englischen auch „Orphan Diseases“ – sie scheinen wie verlassene Kinder, Waisen der Medizin, um die sich niemand kümmert.
So gesehen hatte Roland Reiser Glück im Unglück. Sein Dermatologe überwies ihn an die Havelklinik in Berlin, die sich seit einigen Jahren intensiv mit der Erforschung und Behandlung der Akne inversa beschäftigt. Gegen die Entzündungen bekam Reiser zunächst Antibiotika. Dann wurden die befallenen Hautpartien unter den Achseln erneut entfernt – „regelrecht ausgehöhlt“, beschreibt es Reiser. Es folgte ein langwieriger Wundheilungsprozess. Zwar waren und sind nach wie vor Operationen nötig, und das nicht nur unter den Achseln. Doch diese fallen nicht mehr so heftig aus, weil der körperliche Zustand Reisers regelmäßig kontrolliert wird, neue Entzündungen frühzeitig erkannt werden. Auch mit der Scham hat er gelernt umzugehen – schon allein, weil die Abszesse durch die rechtzeitige Behandlung nicht mehr riechen. Aber: „Wenn es um den Intimbereich geht, ist das zunächst natürlich belastend. Doch ich kann das Thema inzwischen offen ansprechen und habe keine negativen Erfahrungen gemacht.“
GENAU HINSEHEN
Andere Betroffene haben weniger Glück. Es geht nicht nur darum, dass Ärztinnen und Ärzten oft die Erfahrung mit Seltenen Erkrankungen fehlt und sie Symptome deshalb nicht einordnen können. Zu den Tücken einer Orphan Disease gehört auch, dass ihre Symptome denen anderer Krankheiten oft ähneln, falsch zugeordnet und behandelt werden. Ein klassisches Beispiel sind genetische, also angeborene Immundefekte. Vereinfacht gesagt, führen sie vom Kleinkindalter an zu häufigeren Infekten, schwereren Krankheitsverläufen oder machen für ungewöhnliche Erreger anfällig. Nun sind aber Infekte in der Kindheit ganz normal und auch der erwachsene Körper schützt sich mit Immunreaktionen vor fremden Erregern. Es gilt also schon sehr genau hinzusehen, um festzustellen, ob bei einem Kind zum Beispiel eine größere Neigung zu Infekten vorliegt. Zudem kann sich solch ein Infekt in Krankheiten wie etwa einer Lungenentzündung oder einem chronischen Ekzem äußern, die isoliert behandelt werden – auf die Idee, dass dem Ganzen ein grundsätzliches Problem der Immunabwehr zugrunde liegen könnte, kommt lange niemand. Es liegt dann oft in der Hand engagierter Eltern oder informiertem Medizinpersonal, die Krankheitsgeschichte eines Kindes umfassend zu betrachten. Oft führt erst eine genetische Untersuchung zu einer Diagnose – die, auch wenn mitunter viele Jahre ins Land gegangen sind, endlich zur Gewissheit führt und in immer mehr Fällen auch Behandlungsoptionen eröffnet.
FRÜHZEITIGE DIAGNOSE
Zu den Seltenen Krankheiten, die sich in einer Vielzahl von Symptomen äußern, gehört auch Morbus Fabry. Der Name rührt von dem deutschen Dermatologen Johannes Fabry, der Ende des 19. Jahrhunderts zu den beiden Erstbeschreibern der Krankheit gehörte. Betroffene leiden oft schon als Kind unter brennenden Schmerzen in den Händen und am ganzen Körper, abgetan oft als „Wachstumsschmerzen“. Viele kommen mit hohen Temperaturen nicht gut klar, häufig ist auch ein typischer Hautausschlag. Im späteren Leben können Schäden am Herzmuskel, den Nieren oder den Augen hinzukommen. All diese Symptome können ganz unterschiedliche Ursachen haben – deshalb dauert es oft viele Jahre, bis klar ist, dass im Körper von Betroffenen ein bestimmtes Enzym nicht oder nur fehlerhaft funktioniert. Dieses Enzym ist dafür zuständig, Fette, die quasi als „Abfall“ durch Stoffwechselvorgänge in den Zellen anfallen, abzubauen. Ist das nicht möglich, sammeln sich diese Fette an und können die beschriebenen Symptome auslösen. Die gute Nachricht: Morbus Fabry ist behandelbar. Entscheidend ist aber, wie so oft bei Seltenen Erkrankungen, eine frühzeitige Diagnose, um das Risiko für die Schädigung des Körpers so niedrig wie möglich zu halten.
Eine frühzeitige Diagnose: Sie steht auch im Zentrum, geht es um die Amyotrophe Lateralsklerose, abgekürzt ALS. Bei dieser ebenfalls seltenen Krankheit versagen nach und nach wichtige motorische Nerven, sodass die von ihnen versorgten Muskeln nicht mehr funktionieren. Damit ähneln die Symptome denen vieler anderer Krankheiten, die das Nervensystem befallen. Typisch für eine ALS sind in vielen Fällen rasch auftretende Schluck- und Sprechprobleme. Die Krankheit tritt in der Regel zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr auf. Außer bei der seltenen genetisch bedingten Variante sind die Ursachen ungeklärt, die Krankheit ist nicht heilbar. Und sie verläuft sehr schnell, Betroffene versterben in der Regel innerhalb weniger Jahre. Doch bleiben sie bis zum Schluss fast immer bei klarem Verstand. Deshalb zählt hier, aber auf eine ganz andere Weise, die möglichst frühe Diagnose. Es gilt, Betroffenen und ihren Angehörigen so lange wie möglich eine gute Lebensqualität zu schenken. Je früher die Diagnose steht, desto früher kann sich, im Wettlauf gegen das rasche Voranschreiten, um die nötigen Hilfsmittel gekümmert werden – vom elektrischen Rollstuhl bis zum Sprachcomputer.
HOFFNUNGSTRÄGER GENTECHNIK
Frühe Diagnosen werden umso wahrscheinlicher, je höher das Bewusstsein und je größer das Wissen über Seltene Krankheiten im Gesundheitswesen sind. Daneben braucht es zuverlässige Diagnoseverfahren – und die machen sich immer häufiger die Fortschritte in der Genomik zunutze, also der Untersuchung unserer Gene. Das ist nur folgerichtig, sind doch zwischen 70 und 80 Prozent aller Seltenen Erkrankungen genetisch bedingt. Aber auch in der Therapie spielen gentechnische Verfahren eine immer wichtigere Rolle. Hinzu kommt, dass die Pharmaforschung schon seit Jahren zunehmend ihren selbstgestellten Auftrag ernst nimmt und sich eben nicht nur um die Entwicklung von lohnenswerten Therapien für häufige Krankheiten kümmert, sondern ihre Arbeit auch in den Dienst der Behandlung Seltener Erkrankungen stellt. Doch das Beispiel ALS zeigt: Oft kommt es bei Seltenen Erkrankungen einfach darauf an, den Betroffenen den Umgang mit ihrer Krankheit erträglich zu machen, egal, ob ihnen noch viel Zeit oder nur wenige Jahre bleiben. Einen entscheidenden Beitrag leistet hier nicht nur die Medizin, sondern auch jede der zahlreichen Selbsthilfeorganisationen. Sie führen Erkrankte und ihre Angehörigen zusammen, erhöhen bei Ärztinnen und Ärzten, bei den Medien und in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für Seltene Erkrankungen, sammeln Wissen und geben es weiter. Vor allem zeigen sie Menschen, die an einer Seltenen Erkrankung leiden: Du bist nicht allein. Das macht es leichter, die Krankheit zu akzeptieren.
»Die Krankheit verläuft sehr schnell, Betroffene versterben in der Regel innerhalb weniger Jahre.«
EIN STABILES SELBST HILFT
Um das Leben mit der Krankheit ging es auch bei Roland Reiser. Geholfen hat ihm dabei nicht zuletzt eine andere Lebensweise. „Ich habe 60 Kilo abgenommen, meine Ernährung umgestellt und mit dem Rauchen aufgehört“, sagt Reiser. Denn gerade Rauchen und Übergewicht gelten als Faktoren, die Akne inversa verschlimmern. Geholfen haben ihm auch vertrauensvolle Gespräche mit seiner behandelnden Ärztin und seinem persönlichen Umfeld. Und tatsächlich gehörte er zu den Gründungsmitgliedern einer Selbsthilfegruppe. Roland Reisers Geschichte steht beispielhaft für einen erfolgreichen Umgang mit einer Seltenen Erkrankung – für die Kombination aus Diagnose, Behandlung und einem stabilen Umfeld, das zu einem stabilen Selbst führt: „Ich habe akzeptiert, dass meine Krankheit chronisch ist. Die geht nicht weg. Aber auch wenn ich sie nicht verschuldet habe, kann ich viel dafür tun, dass sie nicht so schwer verläuft. Und ich kann auf eine kompetente medizinische Betreuung vertrauen.“