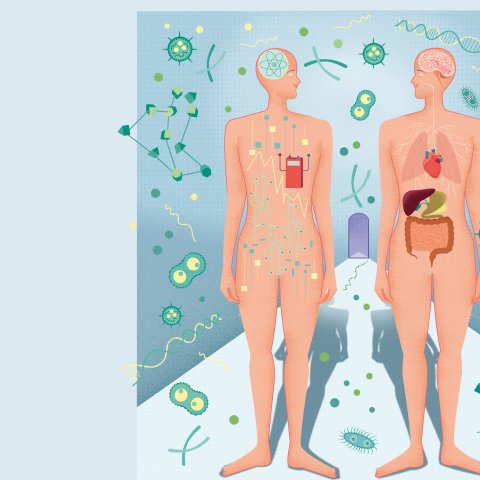Seltene Erkrankungen stellen ein Paradoxon dar: Einzeln werden sie oft übersehen, gemeinsam jedoch betreffen sie über 300 Millionen Menschen weltweit. Derzeit sind mehr als 6.000 seltene Erkrankungen bekannt, wobei es für 95 Prozent davon noch keine Therapie gibt. Ohne die wissenschaftliche Erhebung und Auswertung von Daten bleibt der tatsächliche Einfluss dieser Erkrankungen auf das Gesundheitssystem und die Betroffenen im Dunklen, was eine große Herausforderung für die Therapieentwicklung aber auch für die Patient*innen darstellt. Anlässlich des Welttags der seltenen Erkrankungen am 28. Februar macht AOP Health daher auf die Wichtigkeit von datengetriebener Forschung aufmerksam.
Für das global aktive Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen und in der Intensivmedizin spezialisiert ist, sind Daten weit mehr als Zahlen: Big Data und moderne Analytik ermöglichen es heute, verborgene Muster von Krankheiten zu erkennen, sie so besser zu verstehen und damit neue Behandlungsansätze zu entwickeln. Je fundierter die Daten sind, desto besser nutzbar sind sie in der Therapieentwicklung.
EINBEZIEHUNG VON PATIENT*INNEN
Im Bereich der seltenen Erkrankungen sind die Betroffenen heute überdurchschnittlich gut über ihre Krankheit und die aktuelle Forschung informiert. Sie werden immer häufiger in frühe Phasen der Forschung einbezogen, damit ihre Erfahrungen und Bedürfnisse in die Entwicklung neuer Therapien einfließen können. Dies ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Therapien, der nur erzielt werden kann, wenn die Behandlung die wirklichen Anliegen der Patient*innen adressiert.
WISSENSCHAFTLICHE INNOVATION
Um die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern, setzt AOP Health daher weiterhin auf wissenschaftliche Innovation durch den gezielten Einsatz von Daten und auf die aktive Einbindung der Erfahrungen und Bedürfnisse von Patienten in den Prozess der Therapieentwicklung.
www.aop-health.com
»BALANCE ZWISCHEN REGULATORIK UND BEDÜRFNISSEN DER BETROFFENEN«
Wie verbessert datenbasierte Forschung das Verständnis seltener Erkrankungen und die Erfahrungen der Patient*innen? Machen Daten das „Unsichtbare sichtbar“?
Ja, ich denke, wir befinden uns in einer Ära, in der das Unsichtbare sichtbar gemacht wird. Big Data hilft uns dabei enorm. Die Datenbanken sind besser vernetzt, und je größer sie werden, desto besser können wir mit Hilfe von Data Mining und von Datenanalyse bislang verborgene Muster erkennen.
Warum ist die Erhebung von Daten so wichtig? Welchen zusätzlichen Wert generieren Sie dadurch?
Daten sind für Wissenschaft, Behörden, Medizin und Wirtschaft essenziell. Im Bereich der seltenen Erkrankungen fehlen jedoch oft nicht nur Behandlungsmöglichkeiten, sondern auch grundlegende Informationen über die Krankheit selbst. Daten helfen uns, die Natur der Erkrankung und die Bedürfnisse der Patient*innen besser zu verstehen.
Wie können wir die Perspektive der Patienten in Studiendesigns integrieren? Oft stehen die Anforderungen der zulassenden Behörden im Widerspruch zu dem, was Patienten wichtig ist. Wie können wir diese Lücke überbrücken?
Gerade bei seltenen Erkrankungen ist der frühe Dialog mit Patientenorganisationen entscheidend – das sehen auch Regulierungsbehörden so. Es geht darum, zu verstehen, welche wissenschaftlichen Fragestellungen, Eigenschaften und Sicherheitsaspekte für Patient*innen relevant sind. Während Behörden messbare, objektive Kriterien bevorzugen, wollen Patienten vor allem die Belastung durch die Erkrankung verringern. Sie achten auf Nebenwirkungen, die sie im Alltag besonders beeinträchtigen – etwa eingeschränkte Mobilität oder soziale Einschränkungen. Behörden berücksichtigen zunehmend die Ergebnisse, die aus den Erfahrungsberichten von Betroffenen gewonnen werden. Als Arzneimittelentwickler müssen wir eine Balance finden zwischen regulatorischen Anforderungen und dem, was Patienten wirklich brauchen.