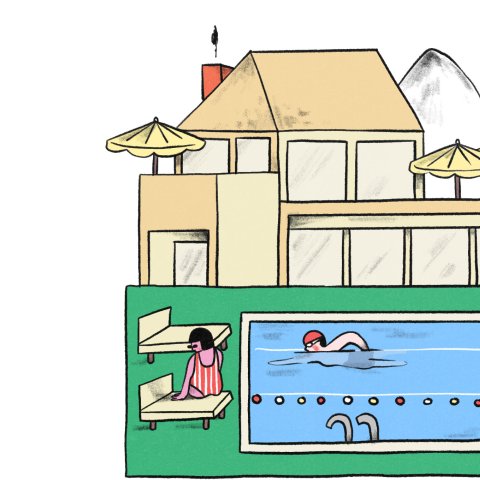Es ist eine kleine Sensation: Forschende am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg haben vor wenigen Wochen erst einen entscheidenden Mechanismus entdeckt, der zur Schwächung des Immunsystems bei Krebs führt. Bisher spricht ein großer Teil der Krebspatienten auf Immuntherapien mit einem so genannten Immun-Checkpoint-Inhibitor nicht an. Die Gründe dafür waren unklar.
Nun konnten die Forschenden am Beispiel einer chronisch lymphatischen Leukämie zeigen, dass das Protein Galektin-9 maßgeblich daran beteiligt ist, dass T-Zellen, die zentralen Akteure der körpereigenen Krebsabwehr, in ihrer Funktion blockiert werden. Dabei fanden sie heraus, dass in den Lymphknoten der Patienten bestimmte T-Zellen stark erschöpft sind. Das Fatale: Erschöpfte T-Zellen verlieren ihre Fähigkeit, Krebszellen effektiv zu bekämpfen. Eine zentrale Rolle bei dieser Erschöpfung spielt Galektin-9, eine Zucker-Proteinverbindung, die die Leukämiezellen in großer Menge ausschütten. Galektin-9 wirkt wie eine Bremse auf das Immunsystem.
An Mäusen konnten die Forschenden bereits zeigen, dass eine Blockade von Galektin-9 die Immunantwort deutlich verbessert und das Tumorwachstum verlangsamt. Gut möglich, dass von diesen Erkenntnissen schon bald diejenigen Patienten profitieren, bei denen die bestehenden Immuntherapien bislang nicht anschlagen.
Innovationssprünge sind in der Krebsforschung selten. Selbst die mRNA-Technologie, bekannt durch die Covid-Impfung und aktuell eine der größten Hoffnungsträgerinnen im Kampf gegen den Krebs, wird noch Jahre brauchen, bevor sie zugelassene Medikamente hervorbringt. In der Regel macht die Forschung kleine Schritte, aber es sind viele. Immer näher kommt die Krebsforschung der Erkenntnis, wie und warum Tumore entstehen, wie ihr Wachstum aufzuhalten ist und wie sie zur Remission und letztlich zum Verschwinden gebracht werden können.
NOBELPREIS FÜR DIE HPV-FORSCHUNG
Das DKFZ, ausschließlich mit öffentlichen Mitteln finanziert, ist dabei enorm erfolgreich. Hier am Institut, das Altkanzlerin Angela Merkel einmal als „Perle in der deutschen Forschungslandschaft bezeichnete, wirkte Professor Harald zur Hausen, der 2008 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Er wies nach, dass Humane Papillomviren (HPV) Gebärmutterhalskrebs verursachen. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung der HPV-Impfung, die weltweit zur Krebsprävention eingesetzt wird.
Bereits bestehende Krebsvorstufen oder Tumore zu bekämpfen, war allerdings bislang noch nicht möglich. Dies könnte sich nun ändern: Ebenfalls am DKFZ und an der Universität Heidelberg haben Forschungsteams kürzlich ein Medikament entwickelt, das auf Nanopartikel aus dem Material Silica, Kieselsäure, setzt. Die Silica-Partikel werden zunächst beschichtet, um sie bioverträglich zu machen. Anschließend werden sie mit kurzen Bruchstücken der in den Krebszellen vorhandenen Virusproteine beladen. Nach der Injektion nehmen Immunzellen die Partikel auf und aktivieren T-Zellen, die gezielt Krebszellen erkennen und zerstören. Im Experiment mit Mäusen, deren Immunsystem „humanisiert“ worden war, konnten bestehende HPV-positive Tumore vollständig zurückgedrängt werden. „Das sind ermutigende Ergebnisse, die uns darin bestätigen, das Nanopartikel-Impfsystem weiterzuentwickeln“, erklärt Studienleiterin Dr. Angelika Riemer. „Es ist vielseitig einsetzbar und könnte in Zukunft nicht nur gegen HPV-assoziierte Krebsarten, sondern auch gegen andere Tumoren oder Infektionskrankheiten eingesetzt werden.“
Es ist nicht der einzige vielversprechende Forschungspfad. Aktuell haben Riemers Kolleg:innen am DKFZ eine Methode entwickelt, die es erstmals ermöglicht, die zeitliche Entwicklung von Körperzellen, von denen eine Krebsgefahr ausgeht, aus einer einzelnen Gewebeprobe zu rekonstruieren. Die Vision der Forschenden ist es, mit dem neuen Verfahren frühzeitig zu erkennen, wenn Krebs entsteht, und diesen Prozess in Zukunft einmal aufhalten zu können.
»Das Nanopartikel-Impfsystem könnte in Zukunft nicht nur gegen HPV-assoziierte Krebsarten, sondern auch gegen andere Tumoren oder Infektionskrankheiten eingesetzt werden.«
KI GEGEN DEN KREBS
Wie schnell aktuelle Forschungsergebnisse in Therapien gegen Krebs einfließen, lässt sich nicht immer sagen. Aber zumindest lassen sich Potenziale abschätzen. So zum Beispiel im Zusammenspiel mit der Künstlichen Intelligenz. Mit dieser Technologie erzielen die DKFZ-Forschenden aktuell ebenfalls große Fortschritte. KI ist in der Lage, große – und stetig wachsende – Datenmengen zu analysieren und Schlüsse aus dem Material zu ziehen. So wird an der Uniklinik in Dresden bei der Brustkrebsvorsorge eine auf KI basierende Software eingesetzt, um sehr frühe Vorstufen von Krebs zu erkennen. Die Software hat Zugriff auf eine enorme Datenbasis, zudem lernt sie mit jedem neuen Befund dazu, wird präziser, treffsicherer.
Am DKFZ hat ein internationales Forschungsteam nun eine KI entwickelt, welche die Aggressivität von Prostatakrebs einschätzen kann. Bislang erfolgt die Einschätzung durch Menschen, durch Pathologen im Labor, die den Tumor in die so genannte Gleason-Skala einordnen. Das neue KI-Modell namens „GleasonXAI“ bietet eine ähnliche Einordnung, wie sie ein Pathologe liefern würde, würde dabei aber subjektive Kriterien ausblenden. Dies könnte den Einsatz in der Praxis beschleunigen und damit in Zeiten steigender Krebszahlen und sinkender Facharztkapazitäten eine wertvolle Hilfe sein.
Ebenfalls für die Urologie entwickelt wurde der UroBot, ebenfalls vom DKFZ in Zusammenarbeit mit der Urologischen Universitätsklinik Mannheim. Der Chatbot beantwortet auf Basis Künstlicher Intelligenz Fragen der urologischen Facharztprüfung und liefert dabei detaillierte, leitliniengestützte Begründungen mit transparenten Quellen. UroBot ist ein frei verfügbares Instrument zur ärztlichen Weiterbildung. Es könnte als Vorreiter für künftige KI-Anwendungen betrachtet werden, das Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit gibt, mit einer automatisiert erstellten Zweitmeinung zu beraten.