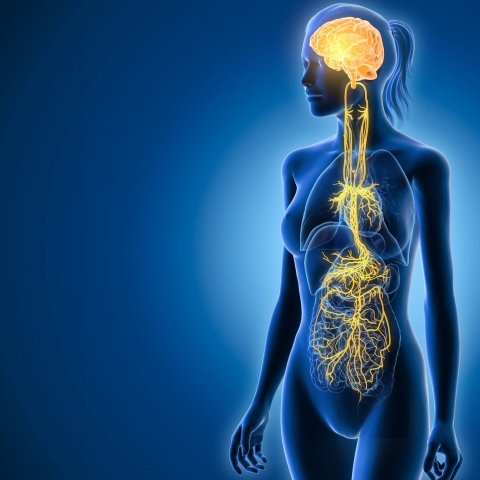Rund 75.000 Herzschrittmacher werden in Deutschland jedes Jahr implantiert. Wenn das Herz zu langsam schlägt oder bei lebensgefährlichen Asystolien, also wenn die elektrische und mechanische Herzreaktion aussetzt, sind Herzschrittmacher seit langem die Therapie der Wahl. Herkömmliche Systeme bestehen aus einem implantierten Aggregat, in etwa so groß wie eine Streichholzschachtel, das eine Batterie sowie die komplette Elektronik enthält. Feine Elektrodenkabel stellen die Verbindung zum Herzmuskel her. Doch so segensreich die Geräte sind, können nach der Implantation auch Komplikationen auftreten, etwa Wundheilungsstörungen, Infektionen, Blutergüsse oder Elektrodenbrüchen. Abhilfe versprechen Herzschrittmacher der neuen Generation: kleine, kabellos funktionierende Kapseln, die über einen Katheter minimalinvasiv direkt in die Herzkammer vorgeschoben werden. Mit winzigen Titanärmchen in der Herzwand befestigt, geben sie dort ihre Impulse ab. Nach dem Eingriff bleiben sie von außen unsichtbar. Die kabellosen Systeme ersparen Patientinnen und Patienten schon während der Operation Schmerzen und Risiken und erhöhen ihre Sicherheit auch danach beträchtlich. Seit Anfang 2022 gibt es dazu aussagekräftige Daten. Im Rahmen einer Studie wurden zwei Jahre lang mehr als 15.000 Patientinnen und Patienten begleitet. Im Ergebnis zeigte sich: Kabellose Schrittmacher schnitten statistisch besser ab als konventionelle Systeme. „Leadless Pacing“ war mit einer um 38 Prozent niedrigeren Reinterventionsrate sowie einer um 31 Prozent reduzierten Komplikationsrate assoziiert, erklärte Professorin Birgit Aßmus vom Universitätsklinikum Gießen bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim. Dennoch sind in Deutschland von den erwähnten rund 75.000 Herzschrittmachern, die jährlich neu implantiert werden, gerade einmal 500 kabellos, was auch an den augenblicklich noch vergleichsweise höheren Kosten liegen mag und daran, dass die Geräte nicht bei allen Herzrhythmusstörungen geeignet sind.
Home-Monitoring verbessert Überlebenschancen
Tendenziell werden Komponenten oder Implantate zur Behandlung von Herzerkrankungen immer kleiner. Gleichzeitig erfüllen sie immer vielfältigere Funktionen, zum Beispiel die Erfassung und Übertragung von Daten. Defibrillatoren etwa beenden durch Stromimpulse schwerwiegende Herzrhythmusstörungen und normalisieren einen zu schnellen Herzschlag. Moderne Geräte können inzwischen – ebenso wie spezielle Geräte zur kardialen Resynchronisation, die den Herzmuskel beim Zusammenziehen unterstützen – über kleinste Sensoren Daten zur Veränderung des Herzrhythmus oder anderer Werte regelmäßig per Datenfunk an die behandelnden Kardiolog:innen senden. Dieses sogenannte Home Monitoring erfasst und analysiert somit Daten, die wichtig sind, um sowohl implantats- als auch gesundheitsbezogene Ereignisse früh zu erkennen. Einer Studie zufolge konnte das Sterberisiko von Menschen mit einem implantierbaren Kardioverter-Defibrillator nach einem Jahr um 38 Prozent gesenkt werden, wenn der Gesundheitszustand der Patienten zusätzlich per Home Monitoring überwacht wurde. Gleichzeitig sank das Risiko, dass Erkrankte wegen einer sich verschlechternden Herzinsuffizienz in die Klinik eingewiesen werden mussten, um 36 Prozent. Auch Smartwatches oder Fitnessarmbänder können mit Hilfe entsprechender Apps mittlerweile Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern erkennen und die Daten unmittelbar an die behandelnden Ärzt:innen weiterleiten, allerdings ohne dabei Konsultation und Diagnose zu ersetzen.