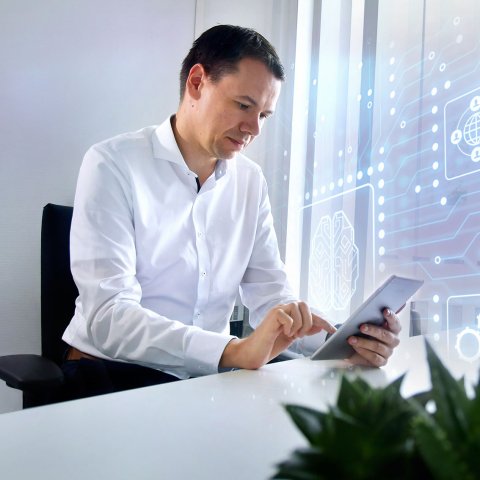Im vergangenen September hat die Deutsche Herzstiftung die jüngste Ausgabe ihres jährlich erscheinenden Herzberichts vorgelegt. Die Zahlen darin zeigen eindrücklich, wie weit verbreitet Erkrankungen des Herzens in Deutschland sind: Mehr als 1,5 Millionen Fälle wurden im Jahr 2021 in Krankenhäusern hierzulande erfasst, das ist nahezu jede zehnte Behandlung in einer Klinik. Trotz eines leichten Rückgangs sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die häufigste Todesursache aller Bürger*innen – nach Angaben des Statistischen Bundesamtes litten von 100 Verstorbenen 33 Prozent darunter. Und nach wie vor sind Männer häufiger und in einem jüngeren Alter betroffen. Den größten Anteil an den tödlich verlaufenden Herzleiden hat die koronare Herzkrankheit (KHK), sie ist für 7,3 Prozent aller Todesfälle verantwortlich – und gerade bei dieser Form der Herzerkrankungen gibt es zwei noch relativ junge Verfahren, die zur Verbesserung der Diagnostik beitragen.
Die Leitlinien der europäischen Gesellschaft für Kardiologie empfehlen in einer Vielzahl von Fragestellungen zuerst ein bildgebendes Verfahren. Die Diagnostik mittels einer Herz-Magnetresonanztomographie (kurz Kardio-MRT) oder einer Kardio-Computertomographie (kurz Kardio-CT) liefert bei vielen Patientengruppen zielführende und dezidierte Diagnosemöglichkeiten. Das Grönemeyer Institut Bochum bietet mit einem 320-Zeilen Volumen-CT sowie mit Herz-MRT-Untersuchungen unter Anwendung modernster Mapping-Techniken und Auswertesoftware nicht invasive Kardiodiagnostik in höchster Qualität. Beide Methoden haben ihre Stärken und sollten unter Berücksichtigung der spezifischen Fragestellung und den individuellen Patienten-Charakteristika ausgewählt werden.



Die Kardio-CT-Untersuchung macht Ablagerungen in den Herzkranzarterien sichtbar. Verengungen werden unter Gabe von Kontrastmittel detailliert dargestellt. Auch die Eigenschaften der Ablagerungen können genau beschrieben werden. Damit ist es möglich, präventive Therapien frühestmöglich einzuleiten, um Herzschäden oder Herzinfarkten vorzubeugen und unnötige invasive Eingriffe (Herzkatheter) zu vermeiden. Die kardiale MRT beantwortet zahlreiche Fragen zum Herzmuskel und der umgebenden Strukturen ohne den Einsatz von Röntgenstrahlen. In einer Untersuchung können sowohl Herzfunktion und -struktur, Wandbewegungen und Durchblutungsstörungen dargestellt werden.
Eine besondere Stärke der Herz-MRT ist die Gewebecharakterisierung des Herzmuskels (z. B. Narben, Fibrose oder entzündliche Veränderungen). Die räumliche Auflösung ist oftmals so gut, dass anhand des Narbenmusters bereits die Ursache erkannt wird. Somit können mehrere Differentialdiagnosen wie Herzkranzgefäßerkrankung, Herzmuskelentzündung und Kardiomyopathie in einer Untersuchung beurteilt werden.
Erfreulich ist, dass das Kardio-CT künftig Kassenleistung wird, das Kardio-MRT leider noch nicht. Einige Krankenkassen sind jedoch Selektivverträge eingegangen, so dass die Kosten für beide Untersuchungsmethoden auch jetzt schon übernommen werden.