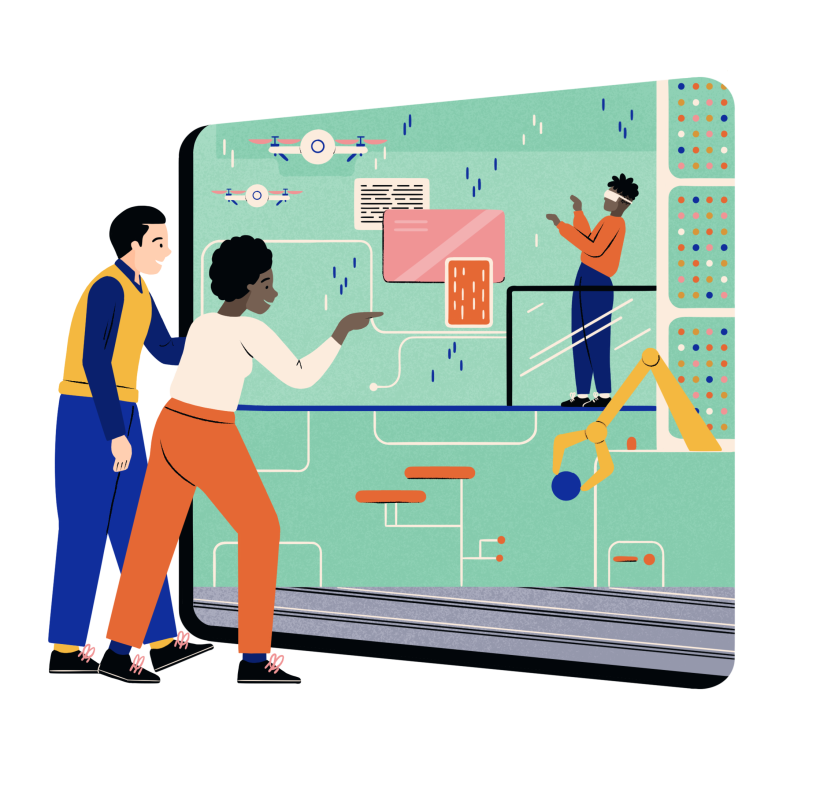Herr Fratzscher, wie lautet Ihre Prognose für Deutschland?
Wir rechnen für 2024 wieder mit einem leichten Wachstum. Dass wir nicht so pessimistisch sind wie manche anderen Institute, hat seine Gründe. Der eine Grund ist, dass wir sehen, dass der private Konsum sich stabilisiert und wieder erstarkt. Vergangenen Winter war der Konsum aufgrund der hohen Inflation und geringer Lohnsteigerungen stark geschwächt. Das hat sich umgedreht: Die Löhne steigen, die Inflation schwächt sich ab, das wirkt sich positiv auf die Kaufkraft aus. Der zweite Grund ist die Weltwirtschaft. Die US-Wirtschaft zeigt sich resilient, wenngleich China ein Unsicherheitsfaktor bleibt. Wir rechnen dennoch damit, dass 2024 die Weltwirtschaft wieder hochfährt. Das ist gut für die Exporte und damit gut für eine Volkswirtschaft wie die deutsche. Der dritte Grund ist die Hoffnung auf eine bessere Stimmung. Meine Beobachtung ist, dass es vor allem Ängste und Sorgen sind, welche die deutsche Wirtschaft derzeit hemmen. Wir leiden an einer mentalen Depression. Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, den Kopf in den Sand zu stecken und sich selbst schlechtzureden, das hilft uns nicht weiter.
Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fehlen der Ampelkoalition 60 Milliarden Euro im Haushalt 2024. Wie sollte die Haushaltslücke geschlossen werden?
Es wäre wichtig, die Schuldenbremse zu reformieren. Schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen ein Umdenken: Zukunftsinvestitionen in die ökologische und digitale Transformation sollten nicht Sparzwängen zum Opfer fallen. Bei den Unternehmen sind verstärkte Investitionen in neue Technologien, in Innovationen und in die Beschäftigten vonnöten. Und das erfordert, dass der Staat gute Rahmenbedingungen setzt. Damit meine ich eine leistungsfähige Infrastruktur in den Bereichen Energie, Digitales, Verkehr. Dazu mehr Geld für Forschung und Entwicklung und deutlich mehr Geld für die Bildung. Deutschland ist zwar nicht in einer Krise, aber doch in einer kritischen Situation, und wir brauchen diese Zukunftsinvestitionen jetzt nötiger denn je. Politik und Gesellschaft sollten jetzt dringend den Hebel umlegen.
Befürchten Sie nicht eine Spirale durch wachsende Schulden bei steigenden Zinsen?
Ganz im Gegenteil. Investitionen sind die beste Schuldenpolitik, weil sie langfristig mehr wirtschaftliche Dynamik schaffen und damit wiederum helfen, Schulden schneller abzubauen. Das zeigen auch unsere Studien. Demnach kommt ein Euro, den der Staat heute in Bildung investiert, langfristig doppelt und dreifach als zusätzliche Steuereinnahme zurück. Menschen werden produktiver, finden bessere und besser bezahlte Arbeit und zahlen letztlich mehr Steuern. Und die Schuldenquote sinkt, auch in diesem Jahr. Der Staat ist der große Gewinner der Inflation. Die Steuereinnahmen sprudeln und die Finanzierungskosten sind nach wie vor sehr günstig. Real, also inflationsbereinigt, liegen die Finanzierungskosten nahe null Prozent. Und das Entscheidende: Wir reden hier nicht über Konsumausgaben, sondern über Investitionen. Wenn man das ökonomisch sieht, sind die Renditen von Investitionen in Bildung und in eine gute Infrastruktur viel höher als die Zinsen, die der Staat dafür zahlt. Ich glaube, dass der Staat es sich gar nicht leisten kann, jetzt nicht zu investieren. Daher halte ich die Finanzierung der Zukunftsinvestitionen über Schulden für deutlich günstiger als die Finanzierung über Steuererhöhungen. Steuererhöhungen in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten wären kritisch. Darüber kann man nachdenken, sobald die Wirtschaft wieder rund läuft.
Die Bundesregierung plant einige Gesetzesvorhaben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Beginnen wir mit der Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe. Ist das eine gute Maßnahme?
Die Senkung der Stromsteuer ist ja nur eine von mehreren Maßnahmen. Energieintensive Unternehmen etwa werden dreifach entlastet, nämlich außerdem über die Rückgabe der CO2-Preise und über Direktsubventionen. Ich sehe diese Maßnahmen aus drei Gründen kritisch: Zum einen werden sie die Deindustrialisierung in Deutschland nicht verlangsamen, sondern beschleunigen. Es werden alte Strukturen zementiert, und es wird verhindert, dass neue Unternehmen mit neuen Ideen schneller in den Markt kommen und sich durchsetzen können. Das wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwächen. Zweitens wird anderen Teilen der Wirtschaft Schaden zugefügt. Subventionen für Strom ziehen einen höheren Stromverbrauch nach sich, was bedeutet, dass die Kosten steigen und auch die Preise für all diejenigen, die keine Subventionen erhalten. Also für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch viele Dienstleistungsbereiche. Der dritte Grund schließlich ist, dass diese Maßnahme eine Menge Geld kostet. Wir reden von einer Summe von 30 Milliarden Euro, über die nächsten Jahre hinweg betrachtet. Das Geld fehlt anderswo, nämlich bei Bildungsausgaben oder bei Investitionen in eine gute Infrastruktur. Diese halte ich für weitaus wichtiger als Subventionen für die Industrieunternehmen.
Das geplante Wachstumschancengesetz enthält Maßnahmen, die Unternehmen ermutigen sollen, in Klimaschutz zu investieren.. Steuerliche Erleichterungen im Bereich der Verlustverrechnung sind geplant, zudem höhere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten im Wohnungsbau. Ist der Entwurf geeignet, um die Wirtschaft anzukurbeln?
Ich bin da skeptisch. Ich sehe das Wachstumschancengesetz als weiteres Geschenk für die Wirtschaft. Es wird vor allem der Industrie zu Gute kommen, mit knapp sieben Milliarden Euro. Ein positiver Aspekt ist die schnellere Abschreibung der Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen. Aber der Effekt dürfte eher marginal sein. Alle Schätzungen zeigen, dass es durch das Wachstumschancengesetz nicht mehr Wachstum geben wird. Und das zeigen auch wissenschaftliche Studien, wie sie etwa vom Industrieverband BDI in Auftrag gegeben wurden. Was die höheren steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten im Bereich des Wohnungsbaus angeht, zeigen unsere Studien, dass diese Option wohl zu vielen Mitnahmeeffekten führen wird. Es sollte aber nicht darum gehen, ohnehin geplante Projekte zu subventionieren, sondern eigentlich sollten zusätzliche Investitionen angeregt werden. Dies aber wird allen unseren Erkenntnissen zufolge nur in sehr geringfügigem Maß passieren.
Welche Maßnahmen wären nötig, um die leidende Immobilienwirtschaft zu stärken?
Ehrlicherweise muss man sagen, dass eine Korrektur auf dem Immobilienmarkt längst überfällig war. Die Branche hatte zehn bis zwölf goldene Jahre mit hohen Margen und enormen Bewertungsgewinnen. Das Problem ist, dass die jetzige Korrektur durch den doppelten Effekt besonders abrupt erfolgt: Höhere Produktionskosten treffen auf höhere Zinsen. Daran kann die Politik nur sehr wenig ändern. Zwei Dinge wären möglich: Zum einen könnte die Regulierung verstärkt werden, damit es nicht zu Exzessen auf dem Mietwohnungsmarkt kommt. Das zweite Instrument wäre eine Ausweitung des Angebots, also genügend Wohnungsbau zu initiieren, um die Branche zu stützen und durch das erhöhte Angebot die Preise zu stabilisieren – eine Maßnahme, die allerdings nur mittelfristig wirkt.
Die Bundesregierung möchte außerdem Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen und Bürokratie abbauen.
Das ist eine gute Initiative der Bundesregierung, um private Investitionen anzukurbeln. Ich halte dieses Projekt für enorm wichtig, aber gleichzeitig auch für sehr schwierig. Denn es erfordert zunächst einen grundlegenden Mentalitätswechsel in der Verwaltung und enorme Investitionen in die Digitalisierung, in die Verschlankung von Prozessen, in schnellere und effizientere Verfahren. In solch einem Wandlungsprozess muss die gesamte Verwaltung mitgenommen werden. Dort herrschen leider hohe Beharrungskräfte. Die Widerstände sind enorm.
Zum anderen werden viele Dokumentationspflichten ausgeweitet. Auf den Mittelstand kommt die Pflicht für Nachhaltigkeitsberichte zu, das Lieferkettengesetz erfordert ebenfalls Berichterstattung. Dazu kommt etwa die Reform des Lobbyregistergesetzes. Drohen weitere Bürokratiemonster?
Ich finde wichtig, Bürokratie von Regulierungen zu trennen. Viele Regulierungen sind wichtig und notwendig, um Transparenz zu schaffen und um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Das andere ist die Bürokratie dahinter, die effizienter arbeiten muss. Hier sind wie bereits erwähnt neue Investitionen gefragt, um die Behörden zu digitalisieren, Prozesse zu verschlanken und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzubilden. Das ist zugegebenermaßen ein schwieriger Spagat, aber man könnte sich im europäischen Ausland hierzu einiges abschauen.
In der Wirtschaft wird der Fachkräftemangel immer wieder als existenzielles Problem bezeichnet. Kann das Fachkräftezuwanderungsgesetz der Bundesregierung, das am 18. November im Kraft getreten ist, daran etwas ändern?
Das Fachkräftezuwanderungsgesetz wird das Problem nur geringfügig verkleinern. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bräuchten wir in der Zuwanderungspolitik einen großen Wurf. Wir müssen viel attraktiver für qualifizierte Zuwanderer werden, zudem brauchen wir eine echte Willkommenskultur. Die gegenwärtige Debatte um Flüchtlinge ist kontraproduktiv, das Einprügeln auf Schutzsuchende perfide. Man will Flüchtende nicht haben, will Grenzen schließen, Asylanträge im Ausland durchführen. Man wird Leistungen kürzen. Die Signalwirkung dieser Migrationspolitik ist verheerend. Gerade unter hochqualifizierten Ingenieuren, Ärztinnen und Ärzten und bei anderen Fachkräften aus dem nichteuropäischen Ausland wird Deutschland noch unattraktiver werden. Wir sind dabei, uns selbst ins Knie zu schießen.
Als Hemmschuh bei der Digitalisierung wird vielfach der strikte Umgang mit persönlichen Daten betrachtet. Andere Länder, China, aber auch die USA, seien offener und daher innovativer. Sind wir zu vorsichtig im Umgang mit unseren Daten?
Datenschutz ist etwas Gutes, und die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO ist prinzipiell ein gutes Instrument. Aber allzu häufig wird Datenschutz als Instrument der Besitzstandswahrung genutzt und vorgeschoben. Nehmen Sie etwa die digitale Gesundheitsakte. Diese wird unter dem Vorwand des Datenschutzes immer weiter verschoben, weil Partikularinteressen ihr entgegenstehen. Dies kostet nicht nur ökonomisches Wachstum, sondern Menschenleben, weil Informationen nicht geteilt werden können. Das gilt auch für andere Bereiche. Datenschutz muss ernst genommen werden, aber er darf kein Selbstzweck sein und nicht über allem anderen stehen.
Der Krieg ist der Vater aller Dinge, so heißt es beim griechischen Philosophen Heraklit. Viel Geld fließt derzeit in Waffen. Können Sie aus ökonomischer Sicht dem Krieg als Innovations- und Wachstumstreiber etwas Positives abgewinnen?
Nicht wirklich. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wird investiert, um Schlimmeres, nämlich eine Ausweitung des Krieges, zu verhindern. Und ja, dieses Geld wird Innovationen schaffen. Es werden mehr Waffen produziert und Kriegstechnologien weiterentwickelt. Aber es sind keine Innovationen, die Wohlstand schaffen und eine Verbesserung des Status quo bedeuten. Besser wäre es, das Geld statt in Panzer und Raketen in Bildung und ein gutes Gesundheitswesen zu investieren. Dennoch halte ich die Entscheidung für richtig, wenn auch für ein notwendiges Übel.