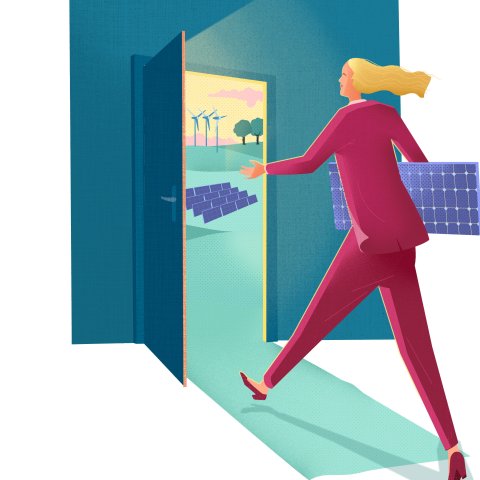Sie haben die Geschichte um „German-free“ vielleicht schon gehört: Angeblich werben Hersteller, speziell aus dem angelsächsischen Raum, damit, dass ihre Produkte ohne Teile auskommen, die in Deutschland hergestellt wurden. „Made in Germany“, kolportiert etwa das Manager Magazin, sei von einem Gütesiegel wieder zu dem „Kainsmal“ geworden, als das es vor 150 Jahren einst eingeführt wurde.
Bei genauerem Hinsehen bleibt nicht viel davon übrig. Deutsche Qualität wird nach wie vor hoch gehalten in aller Welt. Und „German-free“ – das gilt eher für Waffen, damit sie ohne deutsche Freigabe in Krisenregionen exportiert werden können.
Es gibt aber tatsächlich zwei neue Entwicklungen: Zum einen wächst die Konkurrenz, etwa auf dem Automobilmarkt. Chinesische Hersteller sind dabei, auf dem Markt für Elektrofahrzeuge den traditionell innovationsstarken deutschen Marken den Schneid abzukaufen. Zum anderen sorgt die Politik der Bundesregierung für allerhand Häme im Ausland. Speziell in Staaten, die noch vor wenigen Jahren für ihre exzessive Schuldenpolitik von deutschen Politiker und Medien gerügt wurden, ist die Schadenfreude über den 60-Milliarden-Gap im deutschen Haushalt groß.
Um die marode deutsche Infrastruktur instandzusetzen, würde das Geld dringend benötigt (siehe auch das Interview mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher auf den nächsten Seiten). Aber doch nicht, um die Innovationskräfte der Wirtschaft freizusetzen? Hier wäre vielmehr ein „Ruck“ nötig, so wie ihn einst der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog anmahnte – und wie man sich ihn mit Frank-Walter Steinmeier nicht vorstellen kann. Das würde ja Anstrengung bedeuten, ein Sich-Rauswagen aus der Komfortzone.
Und wenn das scheitert? Was für eine Frage: Nochmal versuchen!
Als vor einigen Wochen der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ein Foto in den sozialen Medien postete, kam bei manchen Wehmut auf. Das Bild zeigte das in den deutschen Dornier-Werken gebaute Flugschiff Do-X, das 1932 nach seiner Rückkehr aus New York auf dem Müggelsee gelandet war. Das damals größte Flugzeug der Welt, 40 Meter lang, 48 Meter Spannweite, 12 Motoren, 159 Passagiere, 52 Tonnen Startgewicht, wurde von zahlreichen Paddelbooten und Schiffen umringt, die vor Menschen überquollen. Alle wollten das Weltwunder von nahem sehen, seine Monumentalität, den Luxus und die Sehnsucht nach der Ferne spüren, die das – im übrigen ausschließlich für zivile Zwecke gebaute – Flugzeug ausstrahlte.
Aufschlussreich war sein Kommentar zum Post. „Als die Menschen sich noch wunderten“, schrieb Kowalczuk dazu. Darunter einige Kommentare in der Art, „bekäme heute keine Landeerlaubnis“, „fühlte sich ganz anders an“. Heute würde ein solches Ereignis keine Chance auf Umsetzung bekommen, es gäbe kein Interesse, so könnte man die Reaktionen interpretieren. Keine Faszination gebe es mehr für die Technik, keine Begeisterung für spinnerte Ideen, keine Lust an der Innovation.
Aber warum? Sind wir nicht fähig oder nicht willens, zu begreifen, dass wir an der Schwelle zu etwas stehen, in dessen Vergleich die Do-X anmutet wie eine Bastelei von ein paar Flugzeugmonteuren? Was ist schon ein Flugschiff gegen die Möglichkeiten der globalen Wissensmaschine Internet, der künstlichen Intelligenz, der Raumfahrt, der mRNA-Medizin, der Industrie 4.0? Der Errungenschaften des Reisens, der Kommunikation, der freien Entfaltung in den Industrienationen? Sind die Menschen des Fortschritts überdrüssig, überfordert von der Geschwindigkeit des Wandels, der viele in die Fänge der Rechtspopulisten treibt, die suggerieren, man könne die Welt in ihrem Lauf anhalten?
Die Do-X untermauerte einen Weltruf: dass die „Krauts“ in Sachen Ingenieurskunst einfach nicht zu schlagen sind. Dieser Ruf hielt sich, trotz der Instrumentalisierung von technischem Sachverstand durch die Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten, und er hält sich bis heute. Innovationskraft war auch nach dem Zweiten Weltkrieg stets ein Treiber wirtschaftlichen Fortschritts, und wenn sie nicht in großen Würfen mündete, brach sie sich im Kleinen Bahn. Das galt in der Bundesrepublik wie in der DDR, dem „Land der Knobler und Fummler“, wie die Mitteldeutsche Zeitung einmal schrieb. Die Bundesrepublik, die von den USA zum Bollwerk gegen den Kommunismus erklärt und dementsprechend mit Freiheiten, Geld und Know-how ausgerüstet wurde, wurde zum Land der Tüftler und Erfinder. Hier lief die Innovationsmaschine heiß. Erfinderpersönlichkeiten wie Konrad Zuse, Ferdinand Porsche, Artur Fischer, Jürgen Dethloff und Helmut Göttrup, Adolf und Rudolf Dassler, Karlheinz Brandenburg, um nur einige zu nennen, prägten ihre Zeit.
Das wiedervereinigte Deutschland bündelte die Schaffenskraft von Knoblern und Tüftlern – nur dass im Schatten der Schließung ostdeutscher Betriebe nach der Wende immer mehr Knobler zu den Tüftlern übersiedelten und die dortigen Unternehmen mit ihrem Improvisationstalent verstärkten, so dass heute keine schlüssigen Ost-West-Aussagen in puncto Innovationskraft mehr möglich sind. Es ist eine geografische Aussage, dass die Wachstumstreiber Deutschlands im Westen sind. Es kommen eben mehr Innovationen aus Bayern und Baden-Württemberg als aus Thüringen oder Sachsen-Anhalt.
Deutschland liegt auf Platz vier bei den Patentanmeldungen weltweit. Immer noch sind Ingenieurinnen und Ingenieure die Treiber technischen Fortschritts. Sie produzieren in Teamwork richtungsweisende Innovationen, dazu kommen Innovationsschmieden wie die Fraunhofer-Institute, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die IT Frickler:innen, Medizintechiker:innen, Chemiker:innen, Biolog:innen. Ugur Sahin und Özlem Türeci, die den mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelten. Wer erinnert sich nicht an den Wettlauf der Forscher gegen das Virus, der die Öffentlichkeit in Atem hielt?
Was hierzulande fehlt, sind visionäre, auch ein bisschen spinnerte Projekte wie die Do-X. Und der Mut sie umzusetzen. Als der Berliner Senat neulich vorschlug, eine Magnetschwebebahn in der Hauptstadt zu errichten, zuckten alle müde mit den Schultern. Und wenn das scheitert?
Was für eine Frage: Nochmal versuchen!