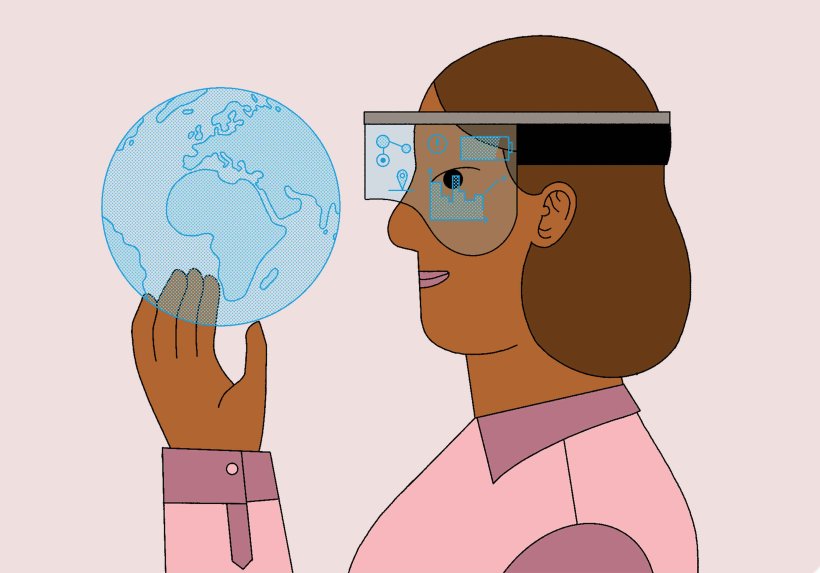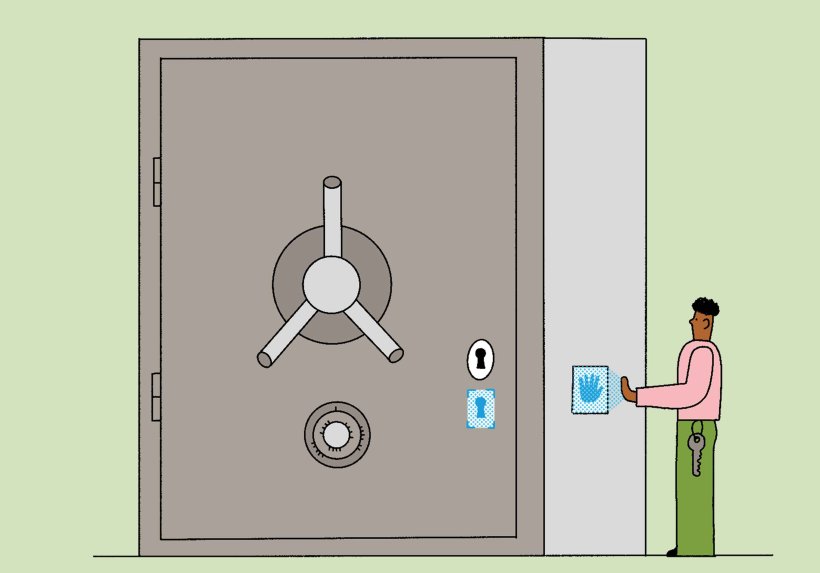Herr Professor Moring, viele Kolleginnen und Kollegen überschlagen sich mit Superlativen, wenn es um Künstliche Intelligenz geht. Wie würden Sie die aktuelle Entwicklung einschätzen?
Ich erlebe zwei Welten: In der Welt der KI passiert sehr viel sehr schnell. Und dann gibt es die Welt der Wirtschaft, konkret die Realität in den Unternehmen. Sie hängen extrem hinterher. Viele sind nicht einmal digitalisiert. Wir erleben die Wiederholung dessen, was wir aus der ersten Phase der Digitalisierung kennen. Nur ist die Entwicklungsgeschwindigkeit diesmal viel schneller als alles, was wir mit der ersten Welle der Digitalisierung gesehen haben.
Die private Nutzung von Chat GPT und anderen Sprachmodellen hat deren Nutzung in der Wirtschaft längst überholt. Sind es Privatanwender, die den Takt vorgeben, und Unternehmen die Nachzügler?
Das könnte man so sagen. Allerdings ist die Nutzung im Privatbereich wenig strukturiert, vieles findet per Trial and Error statt. Sicherlich hat fast jeder und jede schon einmal mit Chat GPT herumgespielt und nutzt das Modell für dies und das, aber ohne zu wissen, welches der beste und effizienteste Umgang mit diesen Sprachmodellen ist. Sie funktionieren ja auf eine bestimmte Art und Weise. Sobald man das aber verstanden hat, kann man sie umfangreicher und besser nutzen.
»Der EU AI Act ist kein Standortvorteil, sondern im Gegenteil ein absoluter Nachteil.«
Wo findet derzeit das KI-Geschehen statt? Und wo stehen Deutschland und Europa im Vergleich?
Die Musik spielt in den USA und in China. Deutschland und Europa sind abgehängt. In den USA liefern sich die großen Anbieter ein Rennen, mit OpenAI, Grok oder Google Gemini. Alle paar Wochen bringt ein Anbieter ein neues Modell heraus, das noch besser ist als das beste bis dato. In China ist die Entwicklung ähnlich schnell. Die chinesischen Entwickler sind mit Deepseek extrem weit vorne. Sie haben, was komplexe Aufgaben angeht, etwa Videoerzeugung und Animationen, die USA bereits abgehängt.
Was macht die Stärke Chinas aus?
Es sind drei Dinge: Manpower, Finanzpower und eine klare Strategie in der Regierung, in den Universitäten und in den Unternehmen. Und dort ist es die Masse, die viel bringt. In China beschäftigen sich sehr viele Menschen mit KI. Je mehr es sind, desto häufiger und schneller kommt natürlich auch etwa Neues, Revolutionäres oder einfach exponentiell Besseres heraus. Dazu kommt viel Geld. Sowohl chinesische Unternehmen als auch die Regierung pumpen enorme Beträge in die KI-Entwicklung. Die Strategie der chinesischen Regierung lautet: Wir wollen die Nummer Eins werden bei KI. Und das wird durchgezogen. Datenschutz oder Regulierungen zählen dabei nicht. Interessanterweise ist es ausgerechnet dieses Einparteienregime, das in diesem Bereich absolute Freiheit gewährt, um zumindest vorerst zu machen, was man will.
Und Europa? Der EU AI Act wird von den politisch Verantwortlichen gern als Standortvorteil verkauft. Sehen Sie das auch so?
Das ist Unsinn und ein typisches Beispiel für gewiefte politische Kommunikation. Die Botschaft ist an die Normalbürger gerichtet, die große Angst davor haben, dass ihre Daten missbraucht werden könnten. Sie lautet: „Wir sind die EU. Wir beschützen euch.“ Der EU AI Act ist aber kein Standortvorteil, sondern im Gegenteil ein absoluter Nachteil, weil er mit unzähligen Regulierungen, Vorschriften, Überprüfungen, Freigaben verbunden ist. Man könnte, statt KI zu regulieren, Datenschutzkonformität über eine Enterprise Lizenz bei Chat GPT gewährleisten. Oder eigene Server einrichten. Somit würden sensible Daten nicht über US-amerikanische Server laufen, sondern über die eigene Cloud. Den Menschen wird suggeriert, der AI Act sei ein umfassender Schutz. Aber für die Unternehmen und für Entwickler bedeutet er einen riesigen Haufen an Bürokratie und zusätzlichen Kosten. Dann überlegt man sich genau, ob man sein Unternehmen hier aufbaut oder nicht doch nach China oder in die USA geht.
Stimmt es, dass Deutschland zumindest bei KI-Anwendungen in der Industrie weltweit führend ist?
Was die Automatisierung in der Industrie anbetrifft, stimmt das. Der Aufbau von KI in der Fertigung und in der Industrie ist eine Mischung aus Innovationsnotwendigkeit und gleichzeitig auch Kostenoptimierung. In Sachen Automatisierung war die deutsche Industrie schon immer vorn, um effizient und wettbewerbsfähig zu bleiben. Konterkariert wird die Entwicklung durch die hohen Energiekosten.
Haben Europa und Deutschland also nur noch die Chance, in Nischen mitzureden?
Wenn auch immer wieder gesagt wird, man wolle ein europäisches Google schaffen – Europa hat es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft. Auch bei KI wird es nicht klappen. Also liegt die einzige Chance in Nischenlösungen, die auf bestimmte Industrien spezialisiert sind, auf Felder, in denen es ein großes Know-how gibt und einen Entwicklungsvorsprung. Aber ich bin mir sicher: Es wird kein großes Sprachmodell oder eine neue KI-Form aus Europa kommen.
Wir haben in Europa Mistral, Aleph Alpha, es gibt ja auch Open GPT-Modelle wie Bayern GPT oder Deutschland GPT...
Das sind die Nischenlösungen, von denen ich spreche. Es sind Variationen, Adaptionen von Modellen, die es bereits gibt. Aleph Alpha wurde vor zwei Jahren extrem gehypt. Und heute? Haben wir bei GPT, Grok und Gemini KI-Reasoning-Modelle, die das gleiche können. Damit ist der einstige USP weg. Wir sehen bei allen KI-Angeboten, dass sie immer mehr voneinander übernehmen – sei es das Reasoning, also Problemlösungsfähigkeiten, seien es Suchfunktionen oder Agentenfunktionen.
An welchen Schrauben könnte man drehen, um die Wettbewerbssituation in Deutschland oder Europa zu verbessern?
In Sachen Rechenzentren sind wir ganz gut aufgestellt. Allerdings kriegen wir spätestens dann ein Problem, wenn wir irgendwo in Deutschland ein neues Rechenzentrum bauen wollen. Mit den Bauvorschriften und Genehmigungszeiten und mit den Zulassungen dauert das viel zu lange. Unsere Internetkapazitäten sind ausreichend, Anwendungsbeispiele haben wir auch genug. Dann das große Hemmnis: Energie ist zu teuer. Bei den Themen Finanzierung und bei Fachkräften sieht es noch schwieriger aus. Da können wir nicht in der globalen Liga mitspielen. Bei der Zuwanderung, die wir nach Deutschland haben, spielen Fachkräfte kaum eine Rolle. In Schule und Ausbildung wird das Thema KI ebenfalls kaum behandelt.
Meta-Chef Mark Zuckerberg zahlt für KI-Talente angeblich 100 Millionen Euro Einstiegsbonus. Ziehen Fachkräfte verstärkt Richtung USA?
Auf alle Fälle. Das ist auch in anderen Bereichen so. Sowohl für Forschung und Entwicklung als auch für Jobs in dem Bereich sind die USA sehr attraktiv, weil dort einfach mehr gezahlt wird. Was heute noch dazukommt, was es in der ersten Welle der Digitalisierung noch nicht so gab: Heute ist Remote Work gang und gäbe. Ich kann für ein amerikanisches Unternehmen in Deutschland, England oder anderswo auf der Welt arbeiten, solange ich Zugriff auf die Infrastruktur habe. Natürlich sind die meisten immer noch vor Ort, aber es gibt zunehmend viele Möglichkeiten, sich gute Leute ins Unternehmen zu holen. Die müssen nicht einmal mehr umziehen.
Was ist mit Start-ups? Gibt es hierzulande ein wesentliches KI-Gründungsgeschehen?
Es gibt sehr viele Start-ups, die aber alle nicht eigene KI entwickeln, sondern auch auf Bestehendem aufsetzen. Ein Problem, das wir in Deutschland und Europa schon immer haben: Entwicklung und Ausgründung sind kein Problem, aber ein Unternehmen zu skalieren und groß zu werden, schon. In Berlin ist mit N8N ein Marktführer bei KI-Agenten für die Workflow-Automatisierung entstanden. Auch das Unternehmen Rows macht einen vielversprechenden Eindruck. Die Macher verknüpfen Data Analytics mit KI.
Wäre es nicht sinnvoller, dass sich Start-ups europäisch vernetzen, anstatt sich von US-Unternehmen übernehmen zu lassen?
Das passiert schon, aber eher auf Metropolenebene. Hier in Hamburg gibt es das ARIC Artificial Intelligence Center mit Vernetzung ins Baltikum und in andere europäische Staaten, bis nach Israel. Städte wie München, Hamburg oder Paris vernetzen sich mit anderen Metropolen und Hotspots in Europa.
Binnen zehn Jahren wird es keinen Job mehr ohne KI geben, sagte der Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil. Gehen Sie mit?
Ja. Es wird keinen Beruf geben, der nicht irgendwie mit KI durchdrungen ist. Das Ausmaß wird natürlich unterschiedlich sein. Je mehr KI in den Bereich Verwaltung, in Bürojobs, vordringt, desto größer ist der Anteil, den sie übernimmt. In den Bereichen Handwerk, zwischenmenschliche Kommunikation, Krankenbetreuung, Kindergarten, Kindererziehung wird der Anteil von KI geringer sein.
»Die Verdichtung der Arbeit in den Jobs wird massiv zunehmen. Auch die Entgrenzung der Arbeit.«
Was bedeutet das Vordringen von KI für die soziale Gerechtigkeit?
Das ist die Schlüsselfrage. Unser soziales Sicherungssystem stammt aus dem 19. Jahrhundert, es ist 150 Jahre alt. Aber wir leben nicht mehr unter Bismarck und im Industriezeitalter des 19. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert passt es nicht mehr und wird zwangsläufig ungerecht. Der Deal, dass die Jungen die Alten über ein umlagefinanziertes Rentensystem finanzieren, funktioniert nicht mehr. Ich sehe als einzige Möglichkeit, den Menschen mehr Verantwortung und Freiheit zu geben, für ihre Versicherung und Alterssicherung selbst zu sorgen und weniger Zwangssolidarität über ein Umverteilungssystem auszuüben. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert nur unter den Prämissen einer günstigen Demographie und einer klassischen Industriegesellschaft. Beides haben wir nicht mehr.
Was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen? Während Wertschöpfung von den Maschinen erbracht wird?
Das ist eine Utopie und ein Märchen. Sicherlich wird der Anteil von maschineller Wertschöpfung und auch KI-getriebener Wertschöpfung immer größer und der Anteil der Wertschöpfung von Menschen kleiner. Das wird aber nicht auf Dauer so bleiben. Denn der Effekt der Automatisierung wird auf der einen Seite sein, dass Jobs wegfallen. Auf der anderen Seite wird die Verdichtung der Arbeit in den Jobs massiv zunehmen. Auch die Entgrenzung der Arbeit wird zunehmen. Das haben wir bereits in den letzten 20 bis 50 Jahren erlebt. Bei jeder technischen Innovation, sei es das Faxgerät, der PC oder die E-Mail-Kommunikation, hieß es, die Arbeit nehme ab und man spare Zeit. Zugleich nahmen der Durchlauf und die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen immer weiter zu. Der Workload wird durch KI noch größer werden. Wir Menschen werden viele nervige Sachen abgeben, aber der Arbeits-, Verarbeitungs- und Entscheidungsdruck wird deutlich höher werden.
Wäre das nicht auch ein Argument für mehr Regulierung von Arbeit?
Letztlich ist es eine Herausforderung für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Wir haben ständig das Smartphone dabei, gucken ständig darauf, sind immer erreichbar. Wir haben ständig Angst etwas zu verpassen. All das wird durch KI verstärkt. Man kann noch so viele Arbeitszeitregulierungen erlassen – am Ende ist die Regulierung eine Frage der Unternehmenskultur und auch der Führung. Und auch der Selbstführung einer jeden Person.
Betrug und Manipulation nehmen mit KI auch massiv zu, Scams werden immer perfekter. Ist hier mehr Regulierung nötig?
Natürlich kann man eine Kennzeichnungspflicht verhängen. Meiner Überzeugung nach wäre es aber wichtiger, wenn jeder und jede Einzelne sich ständig vergegenwärtigt, dass wir nicht in einer virtuellen, sondern in der realen Welt leben. Je mehr ich auf Bildschirme gucke, je mehr ich nur im digitalen Raum kommuniziere und mich dort aufhalte, desto schwieriger wird es, zu entscheiden oder zu unterscheiden, was echt und was nicht echt ist. Je öfter ich meine Geräte weglege und mit Menschen rede, echte Erlebnisse habe, mich in der Natur, in Wind und Wetter aufhalte, desto besser sind meine Wahrnehmung und mein Geist geschult, Fakes und Scams zu erkennen.
Geräte weglegen – machen Sie das selbst auch, Herr Moring?
Ja. Am Wochenende oder auch an anderen Tagen gehe ich in die Natur. Nicht zum Parkspaziergang, sondern ich bin am Strand oder im Wald. Ich bin dort zwei, drei Nächte unterwegs. Ich nehme meine Kinder mit. Ich mache das auch mit Gruppen von Leuten, die diese Ausflüge bei mir buchen. Ich nenne sie Intuitionsworkshops. Ich bringe den Menschen bei, wie sie ihre Intuition, ihr Erfahrungswissen und ihren gesunden Menschenverstand wahrnehmen, entwickeln und anwenden können. Solche natürlichen Kompetenzen brauchen wir in der digitalen Welt mehr als jemals zuvor. Empathie, ein holistisches Verständnis, Intuition – das sind Dinge, die KI nicht kann. Das sind die Domänen von uns Menschen, die uns unsere persönliche Integrität und auch Unabhängigkeit sichern. Und sie werden auch unsere künftigen Jobs sichern.
Sind dies also Kompetenzen, die man als KI-Experte oder KI-Expertin vor allem trainieren sollte?
Genau. In der Konfrontation mit KI stellt sich die Frage: Was macht mich aus? Was kann ich als Mensch exklusiv, was die KI nicht kann und mir auch deswegen nicht wegnehmen kann? Und dann wird es interessant. AI plus AI, wie ich es nenne: Artificial Intelligence plus Archaic Intelligence – das ist ein Hyperbooster für Kreativität, Innovativität und Produktivität, wenn man es richtig kann. Die einzige Chance, nicht von der KI ersetzt zu werden, besteht darin, menschliche Kompetenzen zu schulen und zugleich die KI so gut zu verstehen, dass man sie nutzen kann. Denn nicht die KI wird meinen Job ersetzen, sondern jemand anderes, der KI besser beherrscht als ich.
PROF. DR. ANDREAS MORING
lehrt an der International School of Management ISM in Hamburg. Er hat mehrere Bücher und eine Vielzahl an Artikeln zum Thema Mensch-KI-Interaktion veröffentlicht. Er ist Gründer und Leiter des JuS.TECH Instituts für Data Science, KI und Nachhaltigkeit in Hamburg und „Ambassador für Mensch-KI-Interaktion“ am Artificial Intelligence Center ARIC in Hamburg.