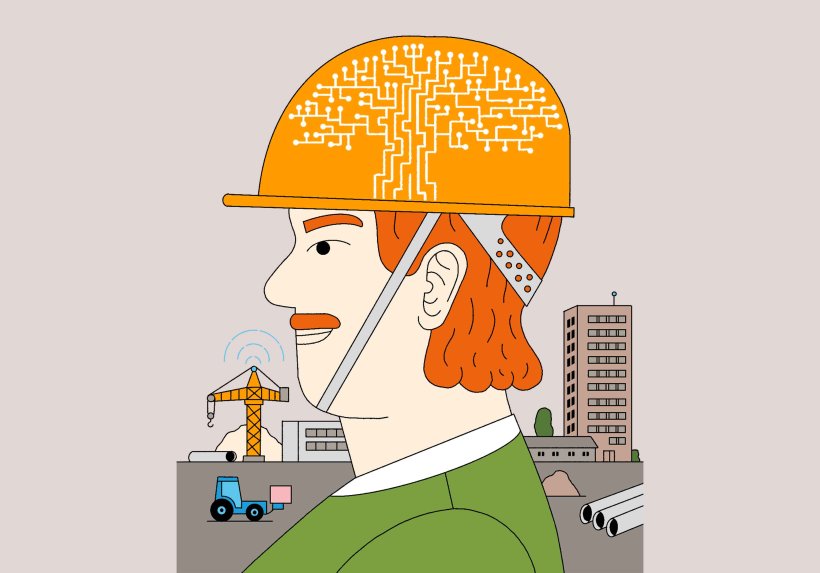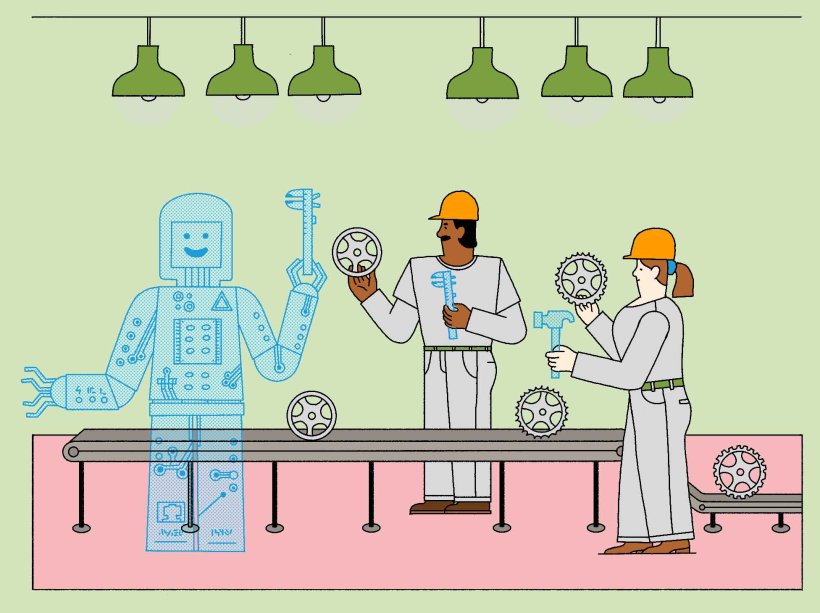Schweißnähte können Facharbeiter ganz schön ins Schwitzen bringen. Von ihnen hängt ab, wie stabil und haltbar das zusammengeschweißte Werkstück am Ende ist. Oder Leiterplatten, diese kleinen Träger für feinste Elektronik. Mit dem bloßen Auge Fehler zu erkennen, ist möglich, aber auf Dauer enorm anstrengend. Die automatische optische Inspektion ermüdet zwar nicht, doch hat Bosch einen Weg gefunden, die Erkennungsquote weiter zu steigern: mit KI. Mittels Vergleichsbildern erkennt sie, wenn etwas nicht stimmt.
Im typischen Fertigungsprozess passieren aber zu wenige Fehler, um die KI damit allein zu trainieren. Also stattete man die eigenentwickelte KI-Plattform zusätzlich mit einer Funktion aus, die selbst Fotos von fehlerhaften Komponenten generieren kann. Man muss dafür nicht „coden“, also programmieren können: Über eine Nutzeroberfläche, ähnlich wie bei einem Webportal, lassen sich die Tools ohne IT-Kenntnisse in verschiedenen Fachbereichen und Anwendungsfeldern bedienen. Für die Mitarbeiter bleibt dank solcher sogenannter No-Code-Lösungen mehr Zeit, um sich anderen Prüfungs- und Fehleranalysen zu widmen, die (noch) nicht von Rechnern übernommen werden können. „Die Lösung ist aktuell weltweit in mehr als 30 unserer Werke im Einsatz“, sagt eine Sprecherin von Bosch. Ein weiterer Vorteil der einheitlichen Plattform ist, dass die IT- und KI-Experten nicht mehr von Werkshalle zu Werkshalle reisen müssen, sondern die Software zentral weiterentwickeln und ausrollen können.
WAS IST MÖGLICH, WAS SINNVOLL?
Nun hat nicht jedes Unternehmen die Ressourcen, die Bosch hat. Und so verwundert es nicht, dass der Forschungsbeirat Industrie 4.0 in Bezug auf KI von einer „deutlichen Diskrepanz zwischen der technologischen Entwicklung und ihrer Anwendung im betrieblichen Kontext“ spricht. Ein Einstieg kostet Zeit und Geld – und das, obwohl am Anfang nicht klar ist, ob sich die Investition auszahlt. Oft fehlen auch Ideen oder das Know-how, wo und wie KI einem Unternehmen konkret weiterhelfen kann.
Die Anwendungsfelder sind außerdem mitunter so individuell, dass es dafür keine Lösungen von der Stange gibt. Viele Studien zeigen aber, dass KI die Wertschöpfung in der Industrie enorm steigern kann. Durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten, vorausschauende Wartung, die Entlastung und Unterstützung von Mitarbeitern und effizientere Prozesse.
Die in der Bauwirtschaft tätige Beratung Drees & Sommer nutzt KI zum Abgleich zwischen der Grundlage zur Bauausführung und der tatsächlich auf der Baustelle ausgeführten Leistung. „Der aktuelle Stand der Baustelle wird anhand von Laserscans erfasst. Anschließend erkennt eine spezielle Software mithilfe eines KI-Modells automatisch die Abweichungen im Vergleich zum Modell und zeigt diese an“, erklärt Wolfgang Kroll, Leiter Digitales Baumanagement und Senior-Projektteamleiter. Die frühzeitige Erkennung reduziert Kosten für Korrekturen deutlich und ermöglicht einen reibungsloseren Bauablauf.
Im Dienstleistungssektor und in den Unternehmensverwaltungen sind vor allem KI-Agenten auf dem Vormarsch. Diese Systeme können auf Basis einer Datengrundlage und Erfahrung autonom handeln, um Aufgaben zu erledigen. Chatbots im Kundenservice sind ein klassisches Beispiel, mit dem mittlerweile viele Menschen in Kontakt gekommen sind, wenngleich sich hinter dem schicken Begriff nicht in jedem Fall KI verbirgt. Ihre Vorteile: Sie sind rund um die Uhr verfügbar und können viele Kundenanfragen beantworten, ohne dass ein Mensch eingreifen müsste. Von tumben Sprachcomputern haben sie sich mittlerweile stark emanzipiert. Ein anderes praxiserprobtes Beispiel sind Empfehlungssysteme: „Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch…“. Sie fördern den Umsatz und bieten den Käufern im besten Fall sinnvolle oder hilfreiche Empfehlungen.
WHO KNOWS?
Forschung und Entwicklung sind für die Chemiewirtschaft ein besonders wichtiges Feld. Wissen ist heute nahezu unendlich verfügbar, doch genau die Informationen, die man sucht, auch zu finden, ist eine Herausforderung. BASF nutzt dafür ein zentrales Wissensportal namens Qknows. Es ermöglicht den Zugriff auf Informationen zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Patenten und BASF-Forschungsberichten. So etwas funktionierte zwar auch früher schon mit einer gut sortierten Bibliothek. Mithilfe von KI lassen sich nun aber Millionen von Fachdokumenten in einfacher Sprache erschließen. Auch komplexe Fragestellungen kann sie schnell beantworten.
KI ist ohne den Menschen allerdings nicht viel wert. Unternehmen stehen hier vor großen Aufgaben: Jobprofile ändern sich, Berufsbilder wie der des Maschinenbedieners verschwinden. Dafür entstehen andere wie der des Data Stewards, der Verantwortung für die Verwaltung, Qualität und Rechtmäßigkeit der verfügbaren Daten trägt. Diese sind der Treibstoff der KI. All diese Anforderungen auszutarieren, wird mancher Personalabteilung Kopfzerbrechen bereiten.
„KI verändert insbesondere Prozesse, die stark dokumentenoder regelbasiert sind – etwa Ausschreibungen, Terminplanung, Qualitätskontrollen oder die Nutzung von Corporate Language“, glaubt Wolfgang Kroll von Drees & Sommer. Parallel dazu entstünden neue Rollen wie KI-Scouts oder Strategie-Teams, die den Wissensaustausch fördern und die Transformation aktiv begleiten. So viel steht fest: KI-Bildung und das Wissen, wie die neuen Werkzeuge sinnvoll und sicher eingesetzt werden können, dürfen nicht vernachlässigt werden. Die Belegschaft braucht Zeit, um sich mit der neuen Technologie vertraut zu machen, damit die potenziellen Mehrwerte auch ausgeschöpft werden können. „Akzeptanz schaffen, Kompetenzen aufbauen, Daten in geeigneter Qualität bereitstellen und zunehmend interdisziplinär zusammenarbeiten“, zählt der Forschungsbeirat Industrie 4.0 einige Empfehlungen auf. Da ist in den meisten Unternehmen sicherlich noch Luft nach oben.