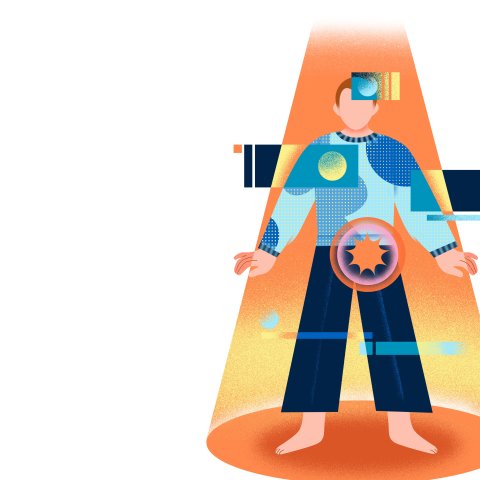Laut den letzten Erhebungen des Statistischen Bundesamts von 2021 verfügen über 53 Prozent der Erwachsenen über einen BMI von 25 oder mehr. Sie sind laut WHO-Definition übergewichtig. Mehr als 20 Prozent der Erwachsenen gelten sogar als adipös (siehe Kasten). Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Und: Die Tendenz ist steigend. Der Anteil der übergewichtigen Erwachsenen in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren um etwa acht Prozentpunkte gestiegen, von unter 45 Prozent auf rund 53 Prozent im Jahr 2021.
Übergewicht und Adipositas erhöhen das Risiko für zahlreiche chronische Erkrankungen erheblich. Dazu zählen Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, bestimmte Krebserkrankungen, Gelenkprobleme und psychische Beeinträchtigungen. Adipositas wirkt sich stark negativ auf die Lebensqualität und Lebenserwartung aus.
Doch wie kommt es zu Übergewicht? Zwar gibt es bestimmte Erkrankungen, etwa der Schilddrüse, die es auslösen können. Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle. Aber in der Regel ist es einfach der Lebensstil, der ein Ungleichgewicht entstehen lässt: Dem Körper wird mehr Energie zugeführt, als dieser verbraucht. Vereinfacht gesagt: Zu viele Kalorien, zu wenig Bewegung.
BAUCHFETT IST BESONDERS GEFÄHRLICH
Bei der Zunahme an Körpergewicht lagert sich das Körperfett an unterschiedlichen Stellen ab. Manche Menschen neigen dazu, an den Oberschenkeln anzusetzen. Andere wiederum legen vermehrt um die Körpermitte zu. Bei der Fettverteilung unterscheidet man im Wesentlichen zwei Typen: Birnen- und Apfeltyp. Der bei Frauen häufige Birnentyp ist gekennzeichnet durch einen vermehrten Fettansatz an Hüften, Oberschenkel und Gesäß. Diese Art der Fettansammlung ist für die Gesundheit weniger gefährlich als die bei vielen übergewichtigen Männern vorherrschende Fettverteilung nach dem Apfeltyp. Eine Körperfettverteilung rund um den Bauch steht in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für Begleit- und Folgeerkrankungen. Das Risiko für Begleiterkrankungen ist auch erhöht, wenn der BMI zwar im Normalbereich liegt, das Fettgewebe jedoch vorrangig im Bauchbereich angesiedelt ist. Liegt eine Adipositas vor, liegt also der BMI bei 30 und mehr, können die gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen erheblich sein, mit negativen Auswirkungen bis hin zu einer niedrigeren Lebenserwartung. Hans Hauner, Vorstandsmitglied der Deutschen Adipositas-Gesellschaft bezeichnete die „Adipositas-Epidemie“ als „eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit. Starkes Übergewicht ist selbst eine chronische Erkrankung und zugleich eine Ursache für die Entstehung schwerwiegender Folgeerkrankungen wie Herzkrankheiten, Schlaganfall, Typ-2-Diabetes und mindestens 13 verschiedene Krebsarten“.
Auch das Gesundheitssystem ist durch Adipositas stark belastet: Die Folgekosten durch behandlungsbedürftige Erkrankungen verursachen hohe Ausgaben. In Deutschland belaufen sich die direkten und indirekten Kosten, darunter Behandlung, Krankheitsausfälle und Produktivitätsverluste, laut Deutscher Adipositas-Gesellschaft auf rund 63 Milliarden Euro jährlich. Zudem sind die Ressourcen in Krankenhäusern und Praxen durch häufigere und komplexere Behandlungen stärker beansprucht. Die steigende Prävalenz von Übergewicht und Adipositas stellen eine wachsende Herausforderung für Prävention und Versorgung dar und erfordert verstärkte politische Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Eine aktuelle Studie der UNESCO, die in Kooperation mit UNICEF veröffentlicht wurde, zeigt, dass weltweit mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig oder adipös sind als untergewichtig. Ein Fünftel der 5- bis 19-Jährigen (etwa 391 Millionen) ist übergewichtig, davon sind rund 188 Millionen adipös. Übergewicht und Adipositas haben Untergewicht als häufigste Form der Fehlernährung in dieser Altersgruppe abgelöst. Die Studie macht vor allem die ständige Verfügbarkeit und aggressive Vermarktung stark verarbeiteter, zucker-, salz- und fettreicher Lebensmittel verantwortlich, die an Orten wie Schulen, Geschäften und über digitale Kanäle verbreitet werden.
BEI BEHANDLUNG: REALISTISCHE ZIELE SETZEN!
Hier besteht auch ein Ansatz für die erfolgreiche Bekämpfung oder Vermeidung von Übergewicht und Adipositas: Hochverarbeitete Lebensmittel und zuckerhaltige Snacks sollten von der Speisekarte verschwinden. Leicht gesagt, erfordert doch eine Ernährungsumstellung eine langfristige Veränderung der Essgewohnheiten und des Lebensstils. Wichtige Grundsätze sind dabei die Reduktion der Kalorienzufuhr, die Auswahl nährstoffreicher Lebensmittel, festgelegte Mahlzeiten und begleitet durch Bewegung und Verhaltensänderungen. Ziele sollten realistisch gesetzt werden. Eine Gewichtsreduktion von 5 bis 10 Prozent kann bereits signifikante gesundheitliche Vorteile bringen. Die Ernährungsumstellung muss individuell an persönliche Vorlieben, berufliche Rahmenbedingungen und Gesundheitszustand angepasst sein.
WANN IST MAN „ADIPÖS“?
Adipositas, umgangssprachlich auch als Fettleibigkeit oder Fettsucht bezeichnet, ist eine chronische Erkrankung, bei der es zu einer übermäßigen Vermehrung des Körperfetts kommt. Medizinisch wird Adipositas ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 definiert. Der BMI errechnet sich aus dem Gewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat und bezeichnet das Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße. Adipositas unterscheidet sich vom Übergewicht dadurch, dass es sich um eine krankhafte Ansammlung von Fettgewebe handelt, welche mit einem erhöhten Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und psychischen Problemen einhergeht. Die Ursachen sind vielfältig und umfassen neben einer ungesunden Ernährung und Bewegungsmangel auch genetische Faktoren, hormonelle Einflüsse und bestimmte Medikamente. Adipositas gilt als eigenständige Krankheit mit erheblichem Einfluss auf die Lebensqualität und Lebenserwartung der Betroffenen.