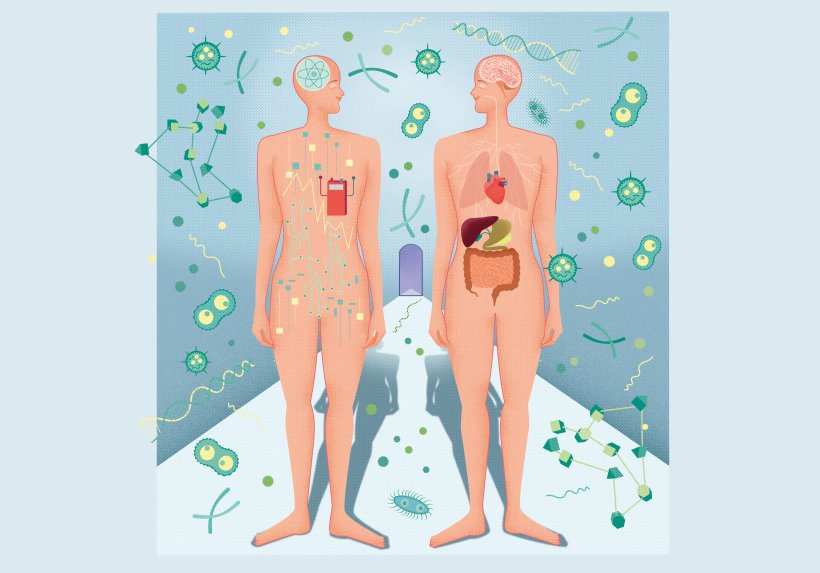Frauen, die ihre Brustkrebsvorsorge am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden absolvieren, können darauf hoffen, dass ein potenzieller Tumor bereits in einem sehr frühen Stadium festgestellt wird. Diese Hoffnung nährt die KI-gestützte Software „Transpara“. Studien haben gezeigt, dass die KI-basierte Software kleinste Knoten und Kalkgruppen, die Vorstufen einer Krebserkrankung sein können, mit bereits vorhandenen Daten von mehr als fünf Millionen Aufnahmen abgleicht und so eine noch frühere Entdeckung möglich macht. Dies erhöht die Chance auf Genesung bei einer Krebsdiagnose – und die Anzahl der Frauen, die eine Brustkrebserkrankung überleben. „Die Untersuchung mithilfe Künstlicher Intelligenz gibt zusätzlich Sicherheit und wird sich künftig zum Standard in der Diagnostik entwickeln“, erklärt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum.
Künstliche Intelligenz ist aus der Medizin nicht mehr wegzudenken. In vielen Bereichen erleichtert KI-basierte Software die Diagnose, macht diese frühzeitiger möglich und präsentiert schneller Untersuchungsergebnisse. KI wird zur Analyse von Röntgen-, CT- und MRT-Bildern eingesetzt. Dadurch können Anomalien schneller und präziser erkannt werden, was zu besseren und frühzeitigeren Diagnosen beiträgt. In der Dermatologie unterstützt KI die automatisierte Erkennung von Hautveränderungen anhand von Fotos. Auch bei der Darmspiegelung ist KI im Einsatz. Ein KI-basiertes System am Universitätsklinikum Freiburg entdeckt dabei laut Klinik-Angaben bis zu zehn Prozent mehr Darmkrebs-Vorstufen.
KI-gestützte Chatbots vergeben Arzttermine, etwa bei der Plattform für Terminmanagement DoctoLib. Sogar in der medizinischen Beratung sind KI-Chatbots tätig. Patientinnen und Patienten können ihre Symptome schildern, während die KI eine erste Einschätzung gibt. In Großbritannien ruhten große Hoffnungen auf dem Chatbot der Software „Babylon Health“. Er verglich Symptome der Anrufenden mit einer Datenbank von Krankheiten, um eine Diagnose und eine geeignete Behandlung zu erstellen. Anschließend sollten Ärztinnen und Ärzte die weitere Beurteilung übernehmen. Die Anwendung stand allerdings in der Kritik, unter anderem wegen mangelnder Reife. Das Unternehmen meldete 2023 Insolvenz an.
PSYCHOLOGIE: APPS SIND BELIEBTER ALS MENSCHEN
Auch bei der akuten Erstbehandlung von psychischen Problemen sind KI-Systeme erfolgreich im Einsatz. Spezialisierte KIs wie etwa der „Woebot“ sind auf psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen trainiert. Auf Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie analysieren sie die Stimmung und die Persönlichkeit des Patienten und schlagen Maßnahmen vor. Eine aktuelle Studie der Ohio State University in den USA zeigte, dass in einem Blindtest mit einem realen und einem virtuellen Therapeuten die Patienten kaum mehr zwischen Mensch und KI unterscheiden konnten. Die digitalen Therapeuten schnitten in der Bewertung sogar besser ab als ihre menschlichen Kollegen. Die Antworten der KI wurden als einfühlsamer und hilfreicher wahrgenommen.
Roboterassistierte Chirurgie mit KI-Unterstützung ermöglicht präzisere Eingriffe, kleinere Schnitte und schnellere Genesung. KI automatisiert Verwaltungsaufgaben wie das Erfassen von Patientendaten, Terminplanung und Vorhersagen zur Bettenbelegung, was das Personal entlastet und Engpässe reduziert. Nicht zuletzt spielt KI eine wertvolle Rolle in der Medikamentenentwicklung. Durch die Analyse großer Datensätze können potenzielle Wirkstoffe identifiziert, klinische Studien optimiert und die Medikamentenentwicklung effizienter gestaltet werden.
Mit zunehmender Verbreitung von KI-Anwendungen werden aber auch Fragen zu Datenschutz, Transparenz und ethischer Verantwortung immer wichtiger. So eigenständig eine KI agieren kann – am Ende bleibt ein Mensch in der Verantwortung für das, was die Künstliche Intelligenz tut. Das hat man auch am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden im Blick. „Die Software ersetzt keineswegs den Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Ärztinnen und Ärzte bleiben in jedem Fall Ansprechpartner“, betont die Bereichsleiterin Mammographie, Dr. Sophia Blum.