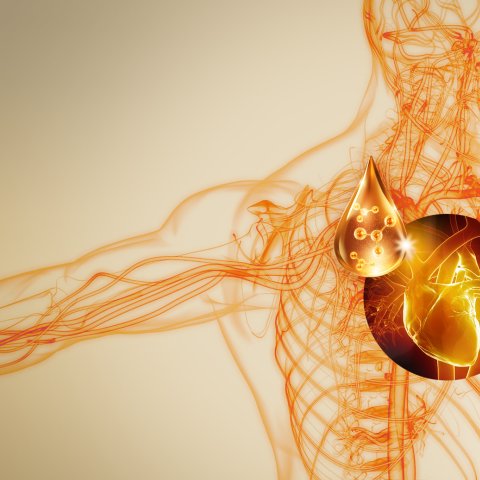Das Immunsystem ist ein scharfes Schwert. Verschiedene Abwehrzellen, zum Beispiel die sogenannten T-Zellen, suchen und zerstören im Körper fremdes Gewebe, Pilze, Bakterien, Viren und Parasiten. Doch ausgerechnet gegen Krebszellen ist das Schwert stumpf. Die Tumoren tarnen sich regelrecht vor der Immunabwehr. Forscher suchen deshalb Wege, das Abwehrsystem so zu manipulieren, dass es Tumorzellen bekämpft.
„Wir aktivieren dabei aber nicht einfach das Immunsystem und dann bekämpft es den Krebs mit T-Zellen“, erklärt Prof. Kurt Miller, Direktor der Klinik für Urologie an der Charité in Berlin. Jahrzehntelang hätten Forscher das ohne vernünftige Ergebnisse versucht. Das Immunsystem sei dazu aber viel zu komplex. Es verfüge über bremsende Faktoren, die Abwehrzellen davon abhalten, auch auf gesunde Zellen loszugehen. Eben diese „Bremsen“ im Immunsystem imitieren die Krebszellen. Bestimmte Rezeptoren, sogenannte Checkpoints, stellen eine Bindung zwischen T-Zelle und Tumorzelle her – und verhindern, dass die Abwehrzelle den Krebs zerstört.
Die Blockade im Immunsystem ausschalten
„Die moderne Immuntherapie versucht, diese Bremsen zu lösen“, so Miller. Die ersten wirklichen Fortschritte dabei machten Forscher vor einigen Jahren mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Diese Substanzen, die per Infusion verabreicht werden, hemmen die Checkpoints, woraufhin T-Zellen den Krebs angreifen können.
Mediziner konzentrierten sich zunächst auf den Checkpoint CTLA-4 – das war aber mit heftigen Autoimmunreaktionen verbunden. Die entfesselten Abwehrzellen wandten sich gegen den Körper und verursachten teils lebensbedrohliche Entzündungen.
Zuletzt erwiesen sich Medikamente, die auf sogenannte PD-1- oder PDL-1-Checkpoints abzielen, in Studien als vielversprechend. „Das Immunsys-tem ist durch sie in der Lage, auch die Zellen metastasierter Tumoren vollständig zu eliminieren“, so Miller. „Das bietet manchen Menschen mit systemischen Tumorerkrankungen eine neue Perspektive und die Chance auf eine Langzeitremission.“ So verlängerten die Inhibitoren in einigen Fällen das Leben von Patienten mit schwarzem Hautkrebs, denen keine andere Therapie mehr half.
Ärzte müssen lernen, mit Immuntherapien umzugehen
Wirken die PD-1/PDL-1-Hemmer, zeigen sie zudem geringfügigere Nebenwirkungen als etwa die Chemotherapie. „Das Management von Nebenwirkungen ist dennoch entscheidend“, sagt Prof. Margitta Retz, Uroonkologin an der Technischen Universität München. In der Praxis sei es für niedergelassene Ärzte schwer, mit der rasanten Entwicklung in der Immuntherapie mitzukommen. Retz und ihr Team entwickeln deswegen unter anderem Checklisten und Anleitungen, die über damit zusammenhängende Nebenwirkungen, Begleiterkrankungen und Notfälle aufklären.
Die Therapien wirken zurzeit auch nicht bei allen Tumoren und jedem Patienten. So sprechen derzeit etwa 25 Prozent der Patienten mit Nierenzellkarzinom auf den PD-1-Inhibitoren Nivolumab an. „Wir wissen, dass der Erfolg von bestimmten Eigenschaften der Tumoren abhängt, etwa von deren Zelloberfläche“, sagt Miller.
Mit Chemo- und Immuntherapie gegen Blasenkrebs
Mittlerweile arbeiten Forscher an immuntherapeutischen Substanzen gegen alle möglichen Arten von Tumoren. Erfolg hatten sie zuletzt etwa bei PD-1/PDL-1-Hemmern gegen Harnblasenkrebs. Sowohl Miller als auch Retz gehen davon aus, dass die Immuntherapie gegen Blasenkarzinome noch in diesem Sommer zugelassen und direkt von den Krankenkassen übernommen wird. Zunächst soll die Behandlung vor allem angewandt werden, wenn eine Chemotherapie nicht möglich ist oder nicht angeschlagen hat. Letzteres ist bei fortgeschrittenen Blasenkarzinomen häufig der Fall – hier können Ärzte heute meist nur noch palliativ behandeln.
Forscher arbeiten an Immuntherapien gegen Prostatakrebs
Retz führt auch bereits Studien zu Immuntherapien als erste, zentrale Maßnahme für Tumoren in Niere, Blase und Prostata durch. Die ersten Ergebnisse erwartet sie 2018 – es ist also abzusehen, dass die derzeitigen Chemotherapien als Standard bald abgelöst werden könnten. „Wir arbeiten aber auch an Therapien, die zum Beispiel bei Prostatakrebs Immun-, Hormon- und Chemotherapie kombinieren“, fügt Retz hinzu.
Die Fortschritte dabei bekommt auch die Öffentlichkeit mit. „In meinen Sprechstunden fragt mittlerweile jeder zweite Patient nach einer Immuntherapie“, so Retz. Vielen erscheine sie als letzte Hoffnung. „Wir werden nicht jedem mit der Immuntherapie helfen können, aber viele werden es nutzen wollen“, gibt Retz zu Bedenken. „Das wird die Kosten im Gesundheitswesen vermutlich stark steigen lassen.“
Gentests finden die Schwachstellen des Tumors
Für die Ärzte stellt sich dann Miller zufolge eine strategische Frage: Sollen sie ausprobieren, ob die Immuntherapie wirkt – ob zum Beispiel ein Patient mit Nierenzellkarzinom zu den glücklichen 25 Prozent gehört? Oder sollen sie die Patienten vorher selektieren? Hier trifft die Immuntherapie auf einen weiteren Trend in der Medizin, individuelle Medizin, die personalisierte, zielgerichtete Therapie. Es geht dabei darum, Patienten mit Gentests bis tief in ihre Zellen hinein zu diagnostizieren. Ärzte können so zum Beispiel die Genome von Tumorzellen entschlüsseln – und abschätzen, ob eine bestimmte Immuntherapie greifen wird.
Solche Genanalysen finden bereits statt, sind aber noch relativ komplex und teuer. Miller denkt, dass die Methode in den nächsten fünf Jahren den medizinischen Mainstream erreichen wird. Forscher werden in dieser Zeit wohl auch die Immuntherapie deutlich weiterentwickelt haben – und zwar fachübergreifend. „Mittlerweile haben die großen Universitätskliniken Tumorboards, mit denen wir wöchentlich gemeinsam Tumoren aus verschiedenen Fachrichtungen angehen“, sagt Retz. „Für die Immunonkologie werden wir solche interdisziplinären Zentren in Zukunft noch an viel mehr Kliniken benötigen.“