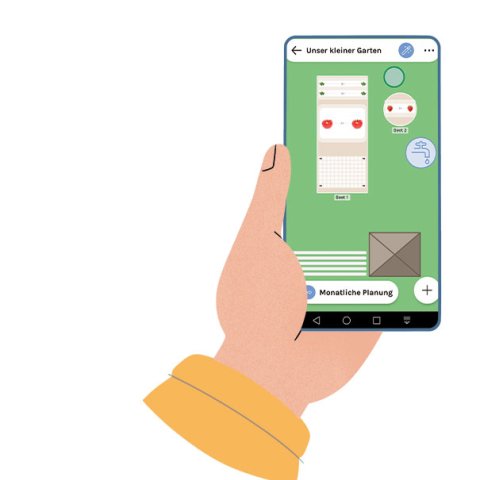Ein Testament zu verfassen, gehört nicht zu den angenehmsten Aufgaben im Leben. Aber: Man muss sich auch nicht unbedingt damit beschäftigen. Denn wenn jemand stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen, dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Das bedeutet vereinfacht gesagt: Erben werden die engsten Verwandten, also Ehepartner, Kinder, Enkelkinder und Geschwister.
Wem das recht ist, der muss sich nicht weiter darum kümmern. Das ist eine durchaus beliebte Vorgehensweise: Etwa 63 Prozent der Menschen ab 46 Jahren haben laut dem Deutschen Zentrum für Altersfragen kein Testament. Wer aber möchte, dass seine Besitztümer anders aufgeteilt werden, der muss ein Testament verfassen. Dabei gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten.
MIT ODER OHNE UNTERSTÜTZUNG?
Das sogenannte eigenhändige Testament muss komplett handschriftlich verfasst sein und am Ende eine Unterschrift aufweisen. Entscheidend ist, dass der eigene Wille klar und eindeutig formuliert wird. Zeit und Ort der Niederschrift anzugeben, ist nicht unbedingt nötig, aber doch sehr empfehlenswert – um es einfacher zu machen, zu entscheiden, welches Testament neuer und damit gültig ist, wenn mehrere Testamente existieren sollten.
Aufbewahren kann man ein derartiges Testament prinzipiell, wo immer man möchte. Hauptsache, es ist im Fall des Falles leicht aufzufinden. Auf Nummer sicher geht man, wenn man das Testament beim Amtsgericht verwahren lässt, das dann im Todesfall automatisch die Erben benachrichtigt. Die Alternative besteht in einem öffentlichen Testament. Dabei erläutert man einem Notar seine Vorstellungen, der sie dann unmissverständlich und juristisch einwandfrei formuliert. Ein derartiges Testament kostet zwar eine Gebühr (bei einem Vermögenswert von 100.000 Euro beispielsweise 273 Euro), kann aber Missverständnisse und damit Streit unter den Erben vermeiden. Ein öffentliches Testament wird zudem immer amtlich verwahrt.
DER PFLICHTTEIL
Der Verfasser eines Testaments kann sehr weitgehend frei bestimmen, wer ihn beerben soll und wer nicht. Allerdings steht den Ehegatten und den Kindern sowie unter Umständen auch den Eltern des Verfassers ein Pflichtteil zu. Entziehen kann man diesen Pflichtteil in einem Testament nur unter sehr engen Voraussetzungen – dann zum Beispiel, wenn der Erbberechtigte sich eines Verbrechens gegenüber dem Verfasser des Testaments schuldig gemacht hat.
GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN
Neben beliebigen Menschen kann man auch juristische Personen als Erben einsetzen, also beispielsweise gemeinnützige Organisationen, Vereine, Bundesländer oder Kirchen. Bei der Auswahl der gemeinnützigen Organisationen gilt dasselbe wie bei Spenden zu Lebzeiten: Wie seriös derartige Organisationen sind und worin ihre konkreten Ziele bestehen, das kann man prinzipiell selbst durch Studieren der Jahresberichte herausfinden. Einfacher ist es, sich auf Gütesiegel zu verlassen, beispielsweise das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen sowie das Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats.