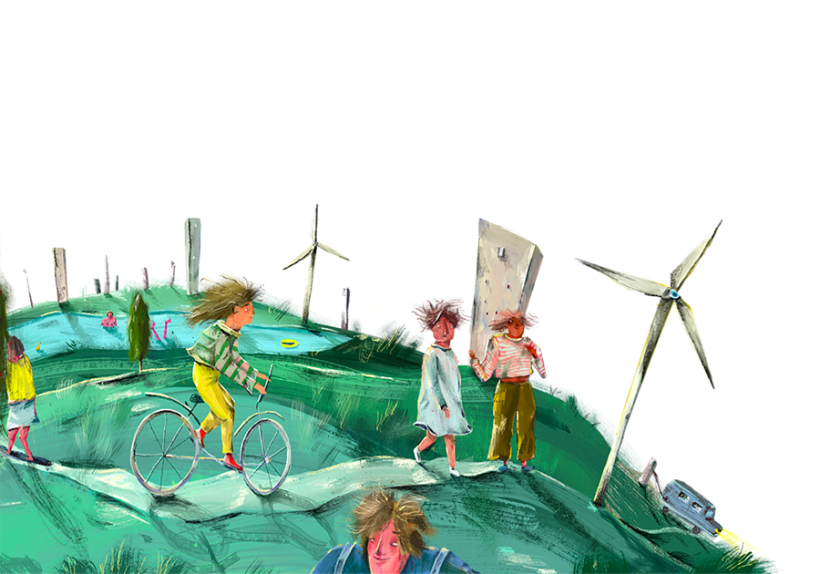Städte sind die Bühne, auf der sich der Klimawandel besonders dramatisch zeigt. Einerseits treiben sie die Erderwärmung voran – rund 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen stammen aus urbanen Gebieten. Andererseits sind sie von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen. Der Unterschied ist spürbar: Während die Temperaturen im Berliner Umland moderat bleiben, bleibt es nachts in der Innenstadt um bis zu 10 Grad wärmer. Prognosen sagen für das Jahr 2100 durchschnittliche Sommertemperaturen in Berlin von fast 29 Grad voraus, das Niveau von Bukarest. In Riad, Saudi-Arabien, könnten die Thermometer sogar 48 Grad erreichen.
Darauf machten auch verschiedene Organisationen des Gesundheitswesens im Rahmen des Hitzeaktionstages am 5. Juni aufmerksam. Man übernehme Verantwortung, denn Deutschland müsse hitzeresilient werden, betont beispielsweise Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt: „Mit dem Hitzeaktionstag wollen wir nicht nur auf die hitzebedingten Gesundheitsrisiken aufmerksam machen. Im Fokus steht die Frage, wie gut Deutschland auf die in Zukunft noch längeren und intensiveren Hitzeperioden vorbereitet ist. Ziel muss es sein, hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu bewahren."
Hohe Temperaturen sind längst nicht mehr nur ein Problem in den Tropen. In dicht besiedelten Stadtgebieten, in denen Beton und Asphalt die Wärme speichern, kann der Alltag zur Qual werden. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke. Paris und Singapur setzen auf eine umfassende Begrünung: Dächer, Fassaden und Straßen werden mit Pflanzen bedeckt, die nicht nur Schatten spenden, sondern auch die Luftqualität verbessern. Diese grünen Inseln senken die Umgebungstemperaturen und sorgen für ein besseres Stadtklima. Wien geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Stadt hat als eine der ersten weltweit einen Hitzeaktionsplan entwickelt, der Trinkstationen, schattige öffentliche Räume und gezielte Aufklärungskampagnen für Risikogruppen umfasst. Neubauten setzen auf reflektierende Materialien und natürliche Belüftung, um die Hitzebelastung weiter zu reduzieren.
ENTWEDER ZU WENIG ODER ZU VIEL WASSER
Während in einigen Regionen Wasser zu einem knappen Gut wird, kämpfen andere Städte mit den Folgen von Starkregen und Überschwemmungen. Kapstadt etwa hat mit einer massiven Dürre zu kämpfen, die die Trinkwasserversorgung gefährdet. Hier setzt man auf Technologien zur Wasseraufbereitung, Regenwassersammelsysteme und die Entsalzung von Meerwasser. Barcelona hat zusätzlich finanzielle Anreize geschaffen, damit Haushalte wassersparende Technologien installieren.
Doch nicht nur der Mangel an Wasser, auch unkontrollierbare Wassermassen stellen eine Bedrohung dar. Im spanischen Valencia oder im Ahrtal haben Starkregenereignisse viele Todesopfer gefordert und immense Schäden angerichtet. Städte wie Rotterdam und Kopenhagen setzen hier auf vorausschauende Planung. Rotterdam kombiniert technische Lösungen wie Rückhaltebecken mit natürlichen Maßnahmen wie der Renaturierung von Flüssen. Kopenhagen gestaltet Parks und Straßen um, sodass sie bei Starkregen große Wassermengen aufnehmen und gezielt ableiten können. Wasserdurchlässige Materialien und unterirdische Wasserspeicher entlasten zusätzlich die Kanalisation.