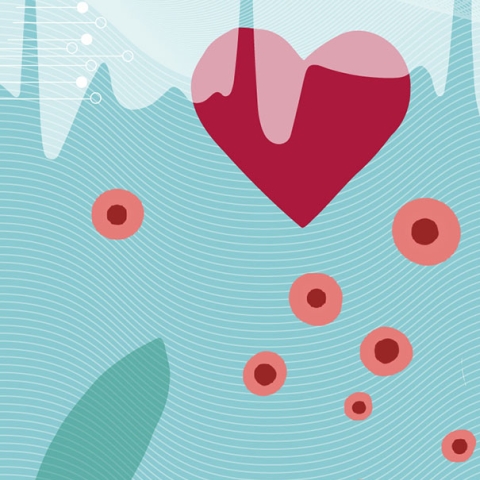Als das Diakonie-Klinikum Jung-Stilling in Siegen im September den „modern-sten Operationssaal Europas“ vorstellte, durfte die Fachwelt einen sogenannten Hybrid-OP der 2. Generation bestaunen. Hier sind moderne Röntgengeräte und Industrieroboter am Werk, Chirurgen können operieren und gleichzeitig in Echtzeit Diagnosen stellen.
Ein Ziel dieser Einrichtung ist es, minimalinvasive Methoden weiterzuentwickeln. Methoden also, die einen lange gehegten Traum der Medizin erfüllen: Sie dringen beinahe ohne Spuren zu hinterlassen in den Körper ein, wo Ärzte dann das Innere des Menschen erforschen und direkt beeinflussen können. Die Bauchdecke mit einem Schnitt zu öffnen, um eine Nebenniere zu entfernen, ist äußerst invasiv. Zum selben Zweck durch eine zentimetergroße Öffnung ein Spezialinstrument – ein sogenanntes Endoskop – einzuführen, ist minimalinvasiv.
Schonendere Eingriffe, neue Möglichkeiten
Das Ziel ist dabei stets, gesundes Gewebe und den Kreislauf der Patienten zu schonen, gleichzeitig aber so viel krankes Gewebe wie möglich zu entfernen. Tatsächlich sind die Vorteile der Schlüssellochtechnik nicht zu verkennen: in der Regel ermöglichen sie schnellere Eingriffe, bessere postoperative Heilung, geringere Belastung, kürzere Krankenhausaufenthalte, kaum Narben. Außerdem lassen sich bestimmte Krankheitsbilder durch sie überhaupt erst chirurgisch behandeln, da bei ihnen eine offene Operation zu riskant wäre.
Natürlich sind minimalinvasive Verfahren, wie alle chirurgischen Eingriffe, dennoch auch mit Risiken und möglichen Nebenwirkungen behaftet. Für Ärzte bringen sie außerdem neue Herausforderungen mit, etwa dass sie den Verlauf der OP nur via Bildschirm verfolgen können.
Schlüssellochchirurgie früher und heute
Zunächst setzten Ärzte das Prinzip vor allem in Körperhöhlen ein, in die sie ohne Schnitte gelangten, etwa im Mundraum und in der Vagina. Frühe Endoskope nutzten im 19. Jahrhundert Spiegel, Linsen und Kerzen, um Bilder aus Körperhöhlen nach außen zu transportieren – was nicht selten mit Verbrennungen einherging. Später statteten Ärzte Endoskope mit elektrischen Glühbirnen aus, in den 1910er Jahren folgten die ersten Bauchspiegelungen (Laparoskopien) mit Hautschnitt und Endoskop. Kurz darauf wurde es üblich, dass Ärzte während der Endoskopie ein Gas (heute Kohlenstoffdioxid) einleiteten, das den Bauchraum aufblähte und so bessere Sicht ermöglichte.
Den größten Durchbruch brachte die Computertechnik in den 1990er Jahren. Mittlerweile sind Endoskope mit Mikrochips und Digitalkameras ausgestattet. Chirurgen bringen durch kleinste Hautöffnungen quasi Miniatur-Computer in Gelenke, Bauchraum, Magen, sogar das Herz ein. Von außen steuern sie unterschiedliche Instrumente, die unter anderem Proben entnehmen, Gewebe etwa durch Laser oder Kälte veröden und via Kamera Farbbilder aus dem Körperinneren liefern.
Die minimalinvasive Chirurgie hat in den vergangenen drei Jahrzehnten in vielen Bereichen der Medizin als Standardverfahren Einzug gehalten. Ärzte entnehmen immer öfter kleinere Organe, etwa Prostata, Blinddarm, Nebenniere und Gallenblase, via Endoskopie aus dem Bauchraum. Magen- und Darmspiegelungen haben sich in der Diagnostik etabliert. Für Diagnosen und chirurgische Eingriffe an Gelenken ist die minimalinvasive Arthroskopie häufig das Mittel der Wahl. Auch minimalinvasive Operationen an der Wirbelsäule, etwa nach einem Bandscheibenvorfall, sind heute möglich.
Augmentierte Realität und Roboter
Nebenbei entwickelt die Technik sich auch nach wie vor weiter. Hochauflösende 3D-Kameras liefern immer bessere und realitätsnähere Bilder aus dem Körperinneren. Außerdem kommt das Prinzip der augmentierten, also erweiterten Realität zum Einsatz. Das bedeutet, Chirurgen erhalten während der OP auf Bildschirmen Informationen, die über das, was die Kamera an bewegten Bildern aufnimmt, hinausgehen. Zum Einsatz kommen dazu unter anderem Röntgenstrahlen sowie Computer- und Magnetresonanztomografie. Sie liefern beispielsweise Details zu Blutgefäßen, die im Kamerabild noch von anderem Gewebe verdeckt werden.
Auch Roboter unterstützen die Ärzte. Chirurgen operieren zwar in der Regel noch selbst am Patienten, Roboterarme können aber während des Eingriffs zum Beispiel ein Röntgengerät an die richtige Stelle bewegen. Ein Vorteil des Roboters ist seine Präzision. Er lenkt die Röntgenstrahlen millimetergenau ans Ziel, sodass die Strahlenbelastung auf ein Minimum reduziert wird.
Digitalisierung und Medizin sind untrennbar
Die Vorzüge der digitalen Technik bringen auch eine gewisse Abhängigkeit von ihr mit sich – ohne Computer geht es nicht mehr, zumindest nicht auf demselben Niveau. Chirurgen müssen zudem lernen, mit der modernen Technik umzugehen und die Informationen, die sie erhalten, in Echtzeit zu verwerten. Unter anderem um diese Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine in Operationssälen zu verbessern, etablieren sich seit ein paar Jahren auch Studiengänge wie Medizinische Informatik und Mediziningenieurwesen. Das alleine zeigt schon: Die Zukunft der Medizin und der Technik hängen mehr denn je zusammen.