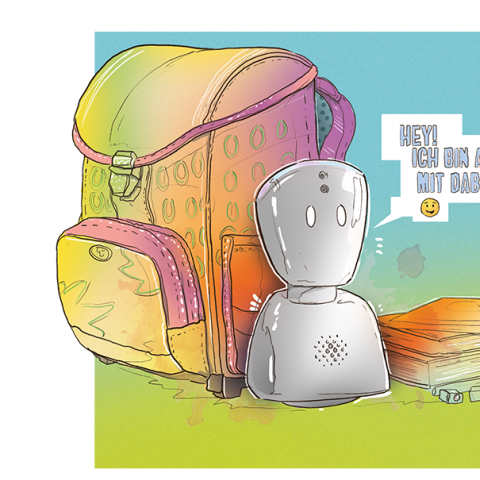Herr Tresp, in den Kliniken fallen bei Diagnose und Therapie riesige Datenmengen an: Blutbilder, Röntgenbilder, genetische Daten. Welche Möglichkeiten der Nutzung sehen Sie?
Bislang arbeitet in der Regel jede klinische Abteilung mit unterschiedlichen Systemen und Formaten. Die Digitalisierung und die Standardisierung könnten die verschiedenen Bereiche der Medizin vernetzen und miteinander in Bezug setzen. Eine Möglichkeit, die sich daraus ergibt, sind ganzheitliche Behandlungsansätze. Dazu kommt die Analyse der Erkrankungen selbst: Einen unstrittigen Vorteil von „Big“ oder auch „Smart“ Data, wie es besser heißen müsste, bietet die Möglichkeit der Differenzierung der Krankheiten. Medikamente mögen bei einem Patienten anschlagen, beim anderen nicht. Das liegt oftmals daran, dass es verschiedende Untererkrankungen gibt, die unterschiedlich zu behandeln sind. Diese Untergruppen können mit Big Data entdeckt werden. Eine Analysesoftware kann zum Beispiel erkennen, dass bei einer Krebsunterart, die von einer bestimmten Mutation ausgelöst wird, eine spezielle Therapie effektiv ist, die bei einer anderen Krebsunterart wirkungslos ist.
Welche Daten nutzen Sie im Projekt KDI?
Zum einen werden Angaben über den Patienten, den Krankheitsverlauf und die Medikation sowie Informationen zur Therapie aufgenommen. Darüber hinaus erhalten wir Genom-Daten, Diagnosedaten aus EKG, CT oder MRT, Text-, - und Bilddaten. Strukturierte Daten wie kodierte Diagnosen treffen also auf unstrukturierte Daten wie Texte und radiologische Bilder. Diese völlig unterschiedlichen Daten wollen wir zusammenführen und sinnvoll auswerten.
Wie erstellt man aus dieser Vielfalt von ganz unterschiedlichen Daten eine sinnvolle Anwendung?
In den medizinischen Einrichtungen erleben wir aufgrund molekularer Daten aus Genom und Proteinanalysen und metabolischen Profilen derzeit eine regelrechte Datenexplosion. Diese Datenmenge wird mittelfristig zu einer Überforderung der behandelnden Ärzte und Pfleger führen. Wir müssen die unstrukturierten Daten in eine Form bringen und mit den strukturierten Daten zusammenführen. Dabei helfen uns Algorithmen. Im Rahmen des Projekts wollen wir die Auswertung dieser umfangreichen und komplexen Patientendaten automatisieren und dadurch drastisch vereinfachen. Dazu werden sämtliche verfügbaren Patientendaten aus unterschiedlichen Quellen zu einem Patientendaten-Modell zusammengeführt.
Welche Erkrankungen untersuchen Sie?
Unsere Fallbeispiele sind der Brustkrebs und die Nierentransplantation. Bei der Nierentransplantation muss der behandelnde Arzt einen Balanceakt vollbringen: Er muss eine Medikation finden, so dass eine Organabstoßung vermieden, aber gleichzeitig Nebenwirkungen minimiert werden. Das dauert oft lange. Wenn dieser Vorgang durch die Auswertung großer fallbezogener Datenmengen beschleunigt werden kann, ist ein klarer Nutzen gegeben: Die Lebensqualität des Patienten wird entscheidend verbessert, und die Behandlungskosten sinken.
Und bei Brustkrebs?
Bei der Behandlung von Brustkrebs können wir zusätzlich auf genetische Daten zurückgreifen. Ein Ziel des Projekts ist es, das Brustkrebsrisiko vorhersagen zu können und eine geeignete Therapie zu erstellen. Dazu werden unterschiedliche Informationen der Patientinnen ausgewertet. Die wichtigsten davon sind Bildinformationen in Mammografien und zum anderen genetische Faktoren und Biomarker. Entscheidend ist es, gezielt Informationen zu generieren und miteinander in Verbindung zu bringen.
Zum Beispiel?
Bei einer Reihenuntersuchung werden Mammografien gemacht. Dabei gibt es bei dichtem Brustgewebe Bereiche, die man nicht gut erkennen kann. Da wäre eigentlich noch ein Ultraschall nötig. Diese Untersuchung ist aber teuer, weil sie lange dauert. Sie wird auch nur dann von den Krankenkassen übernommen, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen. Basierend auf den vorhandenen Informationen könnten wir eine Entscheidungshilfe geben, ob eine Patientin ein Ultraschall bekommen sollte oder nicht.
Woher kommen die Daten, die Sie benutzen?
Hier im Projekt beziehen wir unsere Daten von den beteiligten Partnern. Das sind vor allem die Charité in Berlin und die Universitätsklinik Erlangen. Die Patientendaten im klinischen Umfeld stammen aus zahlreichen Quellen.
Wie groß ist denn Ihre Datenbasis bislang?
Wir können auf Daten von etwa 10.000 Patienten zurückgreifen. Dazu kommen aber auch eigene klinische Studien der Projektpartner. Sie nehmen auch an internationalen Studien teil. Dort sind weltweit mehrere Hundertausend Patienten involviert.
Ein Hindernis für Big Data-Anwendungen in der Medizin sind die großen Bedenken hinsichtlich Datenschutz. Können Sie sie ausräumen?
Langfristig ist es wichtig, dass man Vertrauen schafft. Das kann man am besten dadurch erreichen, dass der Nutzen für den Patienten klar erkennbar wird. Dann ist man bereit, sich darauf einzulassen. Keinesfalls darf der Patient die Anwendungen als bürokratische Belastung mit fragwürdigen Auswertungen und Schlussfolgerungen empfinden. Missbrauch muss effektiv unterbunden und mit empfindlichen Strafen geahndet werden. Allerdings benötigen die Lösungsanbieter auch Rechtssicherheit: Notwendig ist eine eindeutige und möglichst europaweit einheitliche Rechtsprechung.
Prof. Dr. Volker Tresp ist Leiter des Smart-Data-Projekts Klinische Datenintelligenz KDI, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi). Der Professor am Lehrstuhl für Datenbanksysteme der Ludwig-Maximilians-Universität München ist außerdem für Siemens tätig, dem Konsortialführer des Projekts. Weitere Partner sind die Charité in Berlin, die Universitätsklinik Erlangen, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, die Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und die Averbis GmbH.